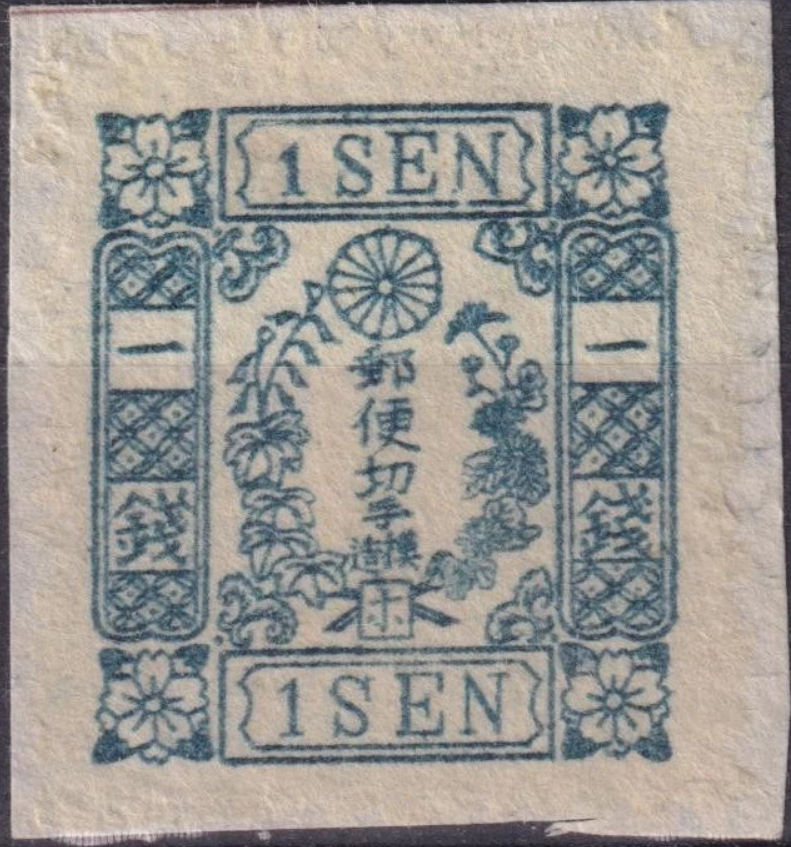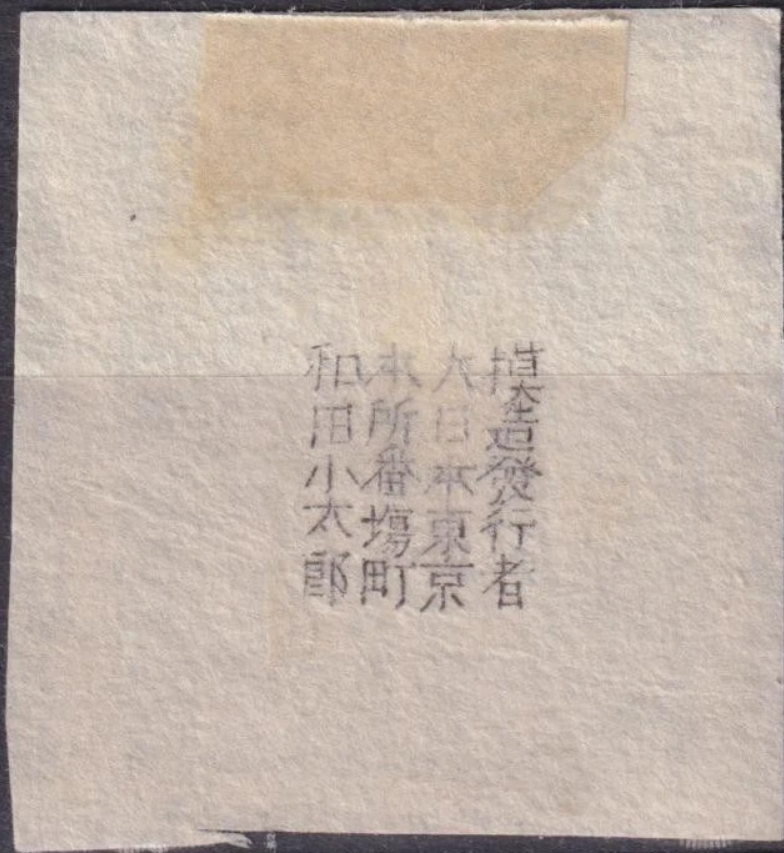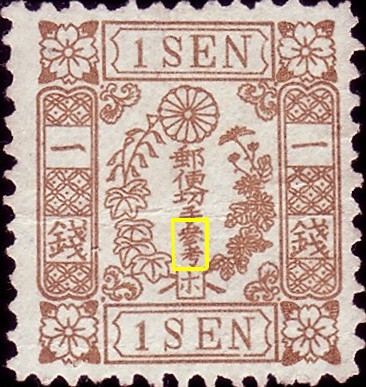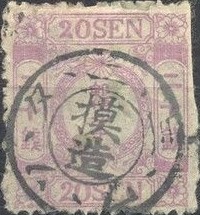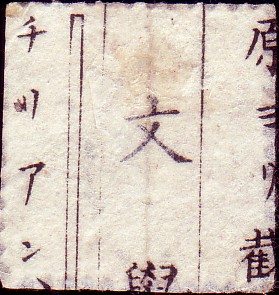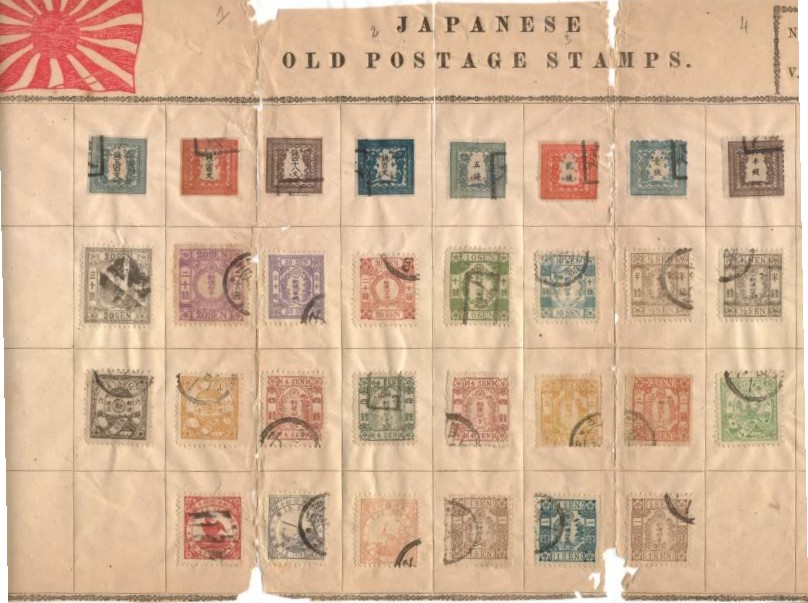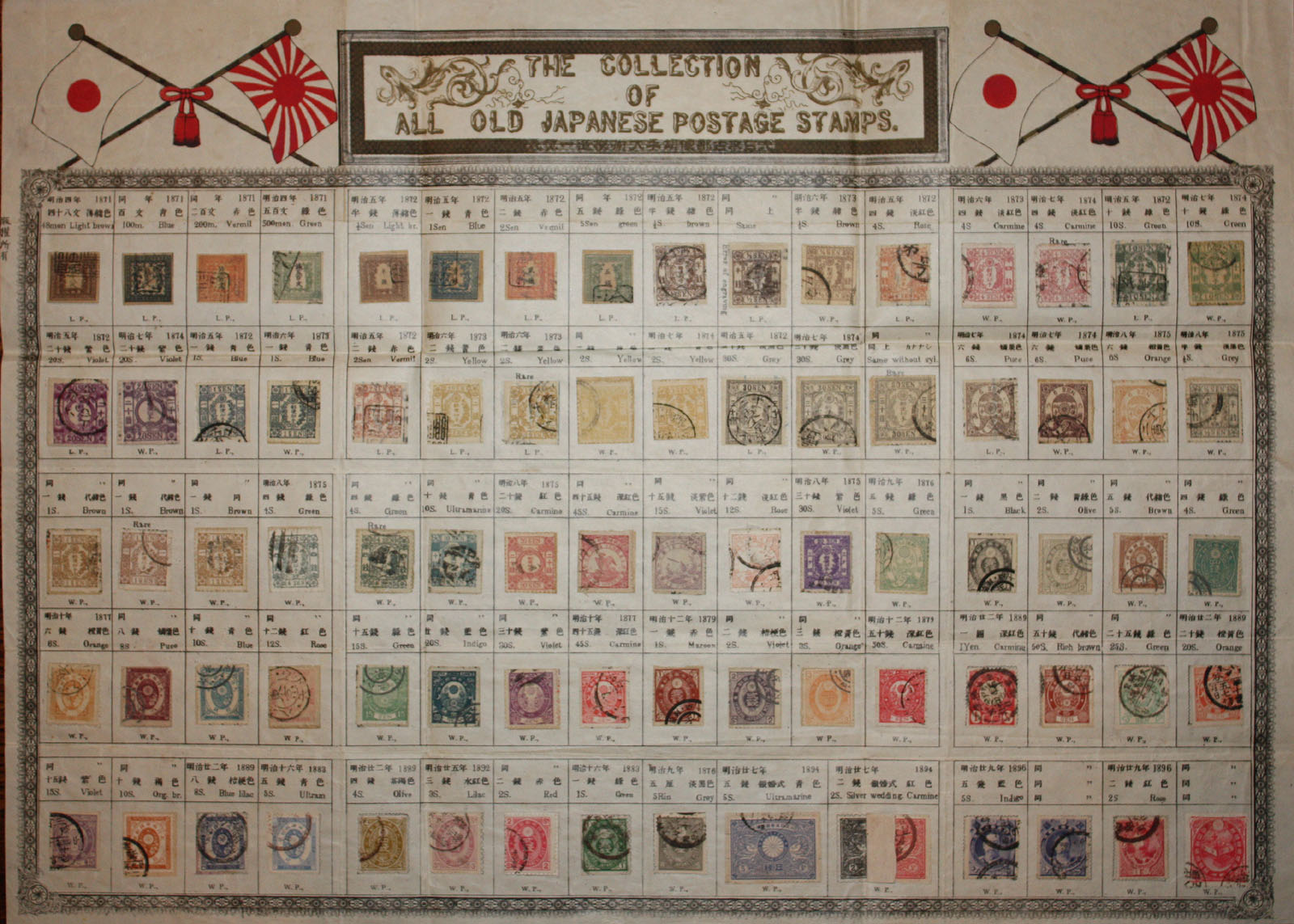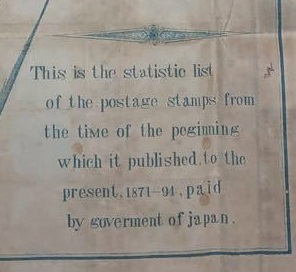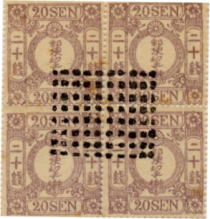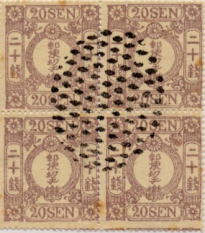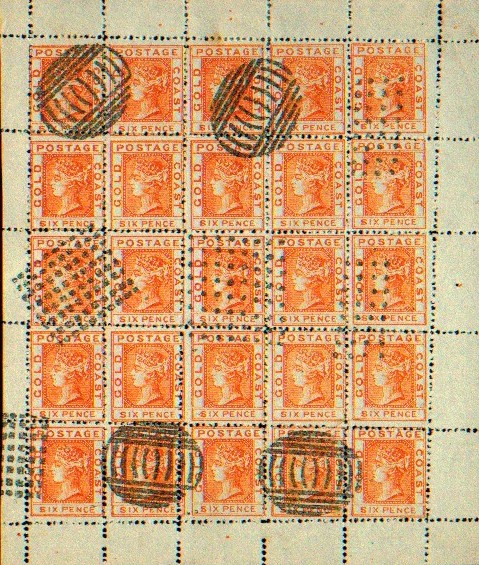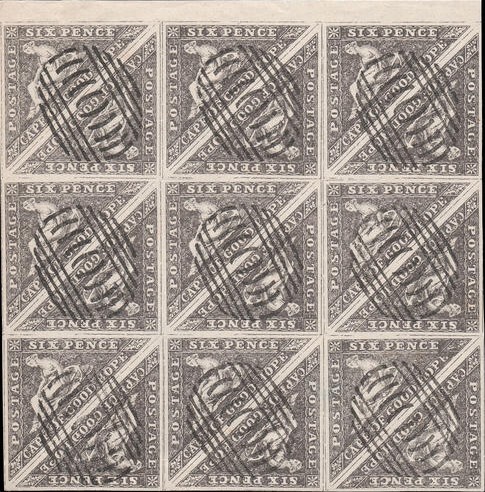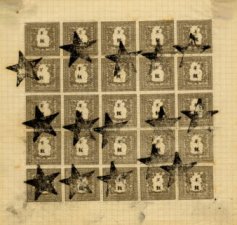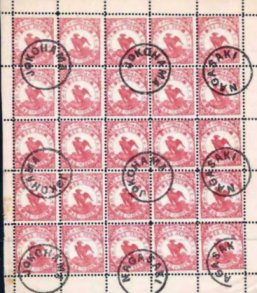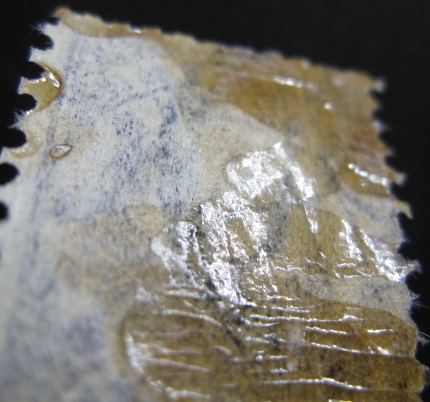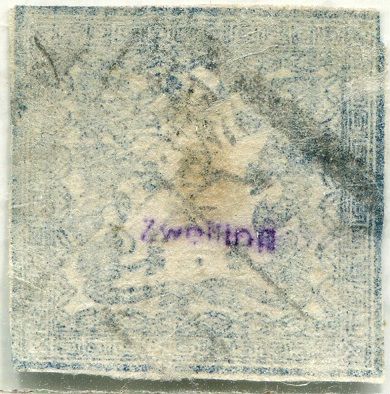|
Später, als die imitierten Marken ab 1890 ungültig wurden, ließ Wada die sanko
und mozo Zeichen
wegretuschieren, neue Platten ohne diese Zeichen gravieren und druckte,
was das Zeug hält. Bedenkt man, dass die heute im Ausland auf dem
Markt befindlichen klassischen Japanmarken zu einem hohen Prozentsatz
von nahezu 90% Wada-Fälschungen sind, muss er mindestens ebenso viele oder gar
mehr Marken gedruckt haben als die japanische Post, was wiederum davon
zeugt, dass ihm diese Produkte förmlich aus den Händen
gerissen wurden. Kaum ein Ausländer, der Japan besuchte,
schipperte ohne eines der verzierten und auf Englisch beschrifteten
Tourist Stamp Sheets, auf denen lauter Wada-Produkte, aber keine
einzige echte Marke pappte, im Gepäck nach Hause. Der gewiefte
Geschäftsmann Wada beschränkte sich nicht auf den Verkauf in
seinem Laden, sondern exportierte seine Tourist sheets auch an
Souvenirshops in anderen ostasiatischen Häfen. Sogar in einer
deutschen Sammlerzeitschrift wurden noch vor Ende des 19.Jhs. 1000
Tourist sheets, direkt zu beziehen bei Firma Wada, für 200 US $
angeboten. Von den Tourist sheets lassen sich die Marken, obwohl sie
nicht gefalzt, sondern aufgeklebt sind, mit einiger Mühe
abwaschen; hierfür verwendete Wada offensichtlich Klebstoff auf
Reiskleie-Basis, der in einem längeren Wasserbad nach und nach
aufweicht.
Ab März 1896 begann die japanische Post, in unregelmäßigen Abständen ein Magazin mit dem
Titel
"Bulletin der Postbriefmarken des Kaiserreichs Großjapan" zu
veröffentlichen. Wada imitierte auch dies und gab schon im
Oktober
des gleichen Jahres eine eigene "Übersicht
über die
Imitationen von Postbriefmarken
des Kaiserreichs Großjapan" heraus, die sofort verboten
wurde.
1905 wurde die Imitation japanischer Postwertzeichen, auch gebrauchter
oder als Imitationen gekennzeichneter, strikt verboten, aber Wada
ließ nur ungern von dem lukrativen Geschäft ab und
machte
heimlich weiter, bis die Polizei um 1911 seine Klitsche
besuchte,
alle Druckplatten konfiszierte und
Wada zwang, seine Restbestände zu verbrennen. Danach zog sich
Wada
aus der Öffentlichkeit zurück und
überließ das Geschäft seinem Sohn Isaburo,
der in
Kanda, im Zentrum
Tokyos, einen ersten Briefmarkenhandel eröffnete und seine
noch immer falschen Produkte dreist sogar den ersten einheimischen
Sammlern anzudrehen versuchte.
Einige
andere Händler taten es
den Wadas nach, aber sie
gaben es nach einigen Versuchen
bald wieder auf, denn das Gravieren und Drucken erschien ihnen wohl zu
aufwendig, die Gewinnmarge zu gering. Wada&Sohn
hingegen
hatten mit ihren Buden an touristischen Brennpunkten und im Hafen von
Yokohama den besten Platz an der
Sonne und
verdienten an den falschen Briefmarken noch mehr als an den falschen
Geishas, Ki(ttel)monos und billigen Glasperlen, weshalb sie
schließlich nur noch Sammlermarken offerierten. Auch ohne
polizeiliches Einschreiten verleideten
ihnen zuletzt das
teure Importpapier und
die moderne Drucktechnik, die für die Kobanmarken verwendet
wurde,
das Handwerk. Ihre ersten Koban-Imitate waren noch
handgraviert, bis die Fälscher auf die einfachere
Lithografie-Technik
umstiegen, aber seit der Kobanserie war frankierte Post in Japan
allmählich genügend verbreitet, um gestempelte
Originalmarken billig auftreiben zu können, und die Produktion
von
Imitaten
rechnete
sich nicht mehr. Dafür finden sich auf den
nunmehr noch üppiger aufgemachten Tourist Stamp Sheets in den
unteren Reihen einige echte, aber billige Marken.
Als 1914 der erste Philatelistenverband in Japan gegründet
wurde,
besaß Wada Junior die Dreistigkeit, für seinen Laden
die
Mitgliedschaft zu beantragen, die ihm im Folgejahr
aber
wieder entzogen wurde.
|
Later, when the imitated stamps lost validity in 1890, Wada had the sanko and mozo marks retouched, engraved new plates without these marks and printed to his heart's content. Considering that nearly 90%
of the classic Japanese stamps on the market abroad nowadays are Wada
forgeries, he must have printed at least as many or even more
stamps than the Japanese postal service, which in turn proves that
these products sold like hot cakes. Hardly any foreigner who visited
Japan sailed home without one of the decorated Tourist Stamp Sheets
with English inscriptions, on which only Wada products were stuck, but
not a single genuine stamp. The shrewd businessman Wada did not limit
himself to selling in his shops, but also exported his tourist sheets
to souvenir shops in other East Asian ports. Even in a German
collectors' magazine before the end of the 19th century, 1,000 tourist
sheets were offered for US$200, available directly from the Wada
company. Although the fake stamps on the tourist sheets are not hinged
but glued on, they can be washed off with some effort; Wada obviously
used rice bran-based adhesive, which gradually softens when soaked in
water for a certain while.
From March 1896 onwards, the Japanese postal service began publishing a
magazine entitled ‘Bulletin of the Postage Stamps of the Empire
of Great Japan’ at irregular intervals. Wada imitated this too
and, in October of the same year, published his own ‘Overview of
Imitations of Postage Stamps of the Empire of Japan’, which was
immediately banned. In 1905, the imitation of Japanese postage stamps,
even used ones or those marked as imitations, was strictly prohibited,
but Wada was reluctant to give up the lucrative business and continued
secretly until the police visited his workshop around 1911, confiscated
all the printing plates and forced Wada to burn his remaining stock.
Wada then withdrew from business and left it to his son Isaburo, who
opened his first stamp shop in Kanda, in central Tokyo, and brazenly
tried to sell his still-counterfeit products even to the early local
collectors.
Some other dealers followed Wada's example, but they soon gave up after
a few attempts, as engraving and printing seemed too costly and the
profit margin too low. Wada & Son, on the other hand, having their
stalls in tourist hotspots and in the port of Yokohama, earned even
more from the fake stamps than from the fake geishas, kimonos and glass
beads, which is why the Wadas eventually only offered collector's
stamps. Even without police intervention, the expensive imported paper
and modern printing technology used for the koban stamps ultimately
ruined their business. Their first koban imitations were still
hand-engraved until the counterfeiters switched to the simpler
lithographic technique, but since the koban series, franked mail had
gradually become widespread enough in Japan that original stamps could
be obtained cheaply, and the production of imitations was no longer
profitable. From that time, the lower rows of the now even more
lavishly decorated Tourist Stamp Sheets contain a few genuine but cheap
stamps.
When the first Philatelic Association was founded in Japan in 1914,
Wada Junior was bold enough to apply for membership for his shop, which was revoked the following year.
|