LAND DES LÄCHELNS
⑦
| ✿❀✿❀ |
VIETNAM |
✿❀✿❀ |
| ⸎ 2001 ⸎ |
Hànôi,
Huê'
und Sàigòn |
☆★✦✬☆★✦✬☆
 Ein Backsteinschlot ragt
aus dem palmbestandenen Rondell, um das Taxis und schwere
Limousinen parken, auf Gäste des 25-stöckigen
Fünfsterne-Hotels Horison wartend. Der Fabrikschornstein, der
sich verschämt im Hotel-Swimmingpool auf der Dachterrasse über
der Eingangslobby spiegelt, kommt sich an diesem Ort gewiss so
fehl am Platze vor wie ein Stadtstreicher auf dem Neujahrsempfang
des französischen Botschafters, aber er ist eines der letzten
Erinnerungsstücke an die Zeit, als Hànôi noch die Hauptstadt
des kommunistischen Nordvietnam war, wo Werktätige beim
Stahlkochen und Panzerschmieden den Buckel krümmten, just da, wo
jetzt Gören aus Sachsen und Dakota auf Liegestühlen am Rand des
Pools träge in die Nachmittagssonne blinzeln und an ihrem
Daiquirí schlürfen. Keine Frage, Vietnam hat sich seit Onkel
Hos Zeiten merklich verändert. Aber witzigerweise sieht es
trotzdem aus wie Vietnam: Ein Ozean von hupenden Knatterrädern
durchpflügt rund um die Uhr die mehrspurigen Boulevards, die
allerorts von Straßenhändlern mit dem
Ein Backsteinschlot ragt
aus dem palmbestandenen Rondell, um das Taxis und schwere
Limousinen parken, auf Gäste des 25-stöckigen
Fünfsterne-Hotels Horison wartend. Der Fabrikschornstein, der
sich verschämt im Hotel-Swimmingpool auf der Dachterrasse über
der Eingangslobby spiegelt, kommt sich an diesem Ort gewiss so
fehl am Platze vor wie ein Stadtstreicher auf dem Neujahrsempfang
des französischen Botschafters, aber er ist eines der letzten
Erinnerungsstücke an die Zeit, als Hànôi noch die Hauptstadt
des kommunistischen Nordvietnam war, wo Werktätige beim
Stahlkochen und Panzerschmieden den Buckel krümmten, just da, wo
jetzt Gören aus Sachsen und Dakota auf Liegestühlen am Rand des
Pools träge in die Nachmittagssonne blinzeln und an ihrem
Daiquirí schlürfen. Keine Frage, Vietnam hat sich seit Onkel
Hos Zeiten merklich verändert. Aber witzigerweise sieht es
trotzdem aus wie Vietnam: Ein Ozean von hupenden Knatterrädern
durchpflügt rund um die Uhr die mehrspurigen Boulevards, die
allerorts von Straßenhändlern mit dem  typischen Strohhut und
Bambustragestangen mit zwei überbordend gefüllten Warenkörben
gesäumt sind. Fahrradrikschas, Kolonialvillen, eine im Zentrum
verschimmelnde Kathedrale sowie ein Haufen Leute, die was von dir
wollen. Und was wohl? - Dreimal darfst du raten. Yeah, Dollars
natürlich. Die Amis haben also doch gewonnen.
typischen Strohhut und
Bambustragestangen mit zwei überbordend gefüllten Warenkörben
gesäumt sind. Fahrradrikschas, Kolonialvillen, eine im Zentrum
verschimmelnde Kathedrale sowie ein Haufen Leute, die was von dir
wollen. Und was wohl? - Dreimal darfst du raten. Yeah, Dollars
natürlich. Die Amis haben also doch gewonnen.
Und
was bekommt man für einen Greenback? 15.000 Ðong, zwei
Pampelmusen, ein Postkarten-Set, fünf Packungen Kaugummi, einen
Stadtplan, ein Pfund Erdnüsse oder einen volkseigenen Büstenhalter
chinesischer Fabrikation. Street-Children soll man die
Schulbildung finanzieren, Einarmige zu Millionären machen,
Tickets für irgendwas kaufen, Rikschas mieten, Rentner
ernähren, Ausflüge buchen und  einsame
Mädchen beglücken. Ich sehe schon, in Hànôi gibt es
allerhand zu tun, ich werde eine Sekretärin und einen
Bilanzbuchhalter einstellen müssen, um allen Wünschen gerecht
zu werden.
einsame
Mädchen beglücken. Ich sehe schon, in Hànôi gibt es
allerhand zu tun, ich werde eine Sekretärin und einen
Bilanzbuchhalter einstellen müssen, um allen Wünschen gerecht
zu werden.
Nun
hat uns die Natur leider zu egoistischen Zeitgenossen gemacht,
die ihre eigenen Wege gehen, und die führen uns in die Altstadt
an den malerischen Innenstadt-Teich Hoàn Kiê'm und von
dort ins
Theater, denn eine Wasserpuppen-Vorstellung sollte man in
Hànôi nicht versäumen. Da schwappt ein
künstlicher See im
Theaterraum anstelle der sonst üblichen Bühne, und zu den
Klängen einer vietnamesischen Live-Combo plitschen Fische,  feuerwerkspeiende Drachen,
Boote, Angler und Mandarine im Puppenformat durch die Brühe, von
den Puppenspielern mit Unterwasser-Stangen bewegt, und nach dem
Schlussapplaus kommen die Künstler hinter den Kulissen hervor,
bis zur Hüfte im nassen Becken watend. Wen die Plantscherei
durstig gemacht hat, der labt sich am lokalen Hopfenbräu Bia Hà Nôi (Bier heißt tatsächlich Bia auf
vietnamesisch), am besten in dem hervorragenden, aber nach
unseren Maßstäben preiswerten De-luxe-Seafood-Gartenrestaurant
Phô Bién, wo es mehr nach Ho-Chi-Michelin-***-Sternen als nach
Sozialismus schmeckt.
feuerwerkspeiende Drachen,
Boote, Angler und Mandarine im Puppenformat durch die Brühe, von
den Puppenspielern mit Unterwasser-Stangen bewegt, und nach dem
Schlussapplaus kommen die Künstler hinter den Kulissen hervor,
bis zur Hüfte im nassen Becken watend. Wen die Plantscherei
durstig gemacht hat, der labt sich am lokalen Hopfenbräu Bia Hà Nôi (Bier heißt tatsächlich Bia auf
vietnamesisch), am besten in dem hervorragenden, aber nach
unseren Maßstäben preiswerten De-luxe-Seafood-Gartenrestaurant
Phô Bién, wo es mehr nach Ho-Chi-Michelin-***-Sternen als nach
Sozialismus schmeckt.
Mindestens
8 Millionen Vietnamesen nennen sich Nguyên, und einer davon
heißt mit Vornamen Thóng und will von mir wissen, warum die
Deutschen eine Altherren-Mannschaft zur Fußball-WM nach
Frankreich entsandt hätten. Gute Frage, Monsieur Nguyên! Das
hätte ich nämlich auch gern gewusst. Vietnam ist restlos
fußball-begeistert, über Fußball kommt man mit jedem
männlichen Vietnamesen ins Gespräch, auch ohne Vietnamesisch zu
beherrschen. Schalke 04? Kein Problem, ist jedem geläufig. Zwei
Bundesliga-Spiele pro Woche werden im staatlichen Fernsehen
übertragen, da weiß jeder Vietnamese, wo Unterhaching liegt und
an welcher Verletzung "Stinkefinger" Effenberg
laboriert. Ansonsten hat Mr. Nguyên eine erhebliche Schwäche
für hübsche junge Damen und klärt mich auf über die
Preiskategorien in Hànôi. Ich  erfahre von diesem
Matratzen-Fachmann, dass die vielen Karaoke-Häuser an den
Ausfallstraßen der City nicht nur Musik, Drinks und Mikrofone
für das Amateur-Gekrächze betrunkener Schlagerfans
bereitstellen, sondern meist auch Hinterzimmer mit Bett; eine
Gefährtin für die Kissenschlacht kann man an der Kasse gleich
dazumieten, das nenne ich neuzeitlichen Service! Die 25 Dollar
für eine junge, langhaarige Schönheit habe er schon beinahe
zusammen, grinst Mr. Nguyên und fasst an die Brusttasche seines
Sommerhemdes, in der ein dickes Bündel Dollarnoten....
erfahre von diesem
Matratzen-Fachmann, dass die vielen Karaoke-Häuser an den
Ausfallstraßen der City nicht nur Musik, Drinks und Mikrofone
für das Amateur-Gekrächze betrunkener Schlagerfans
bereitstellen, sondern meist auch Hinterzimmer mit Bett; eine
Gefährtin für die Kissenschlacht kann man an der Kasse gleich
dazumieten, das nenne ich neuzeitlichen Service! Die 25 Dollar
für eine junge, langhaarige Schönheit habe er schon beinahe
zusammen, grinst Mr. Nguyên und fasst an die Brusttasche seines
Sommerhemdes, in der ein dickes Bündel Dollarnoten....
...vor wenigen
Minuten noch gesteckt hatte.
-------- Fort !!!! Geklaut !!!
Er kann es nicht fassen, er, der
Sohn des Polizeipräfekten von Hànôi, dass Taschendiebe am
Ngoc So'n Tempel ihm die
Barschaft aus dem Hemde gezupft haben und nicht uns, den
"reichen" Touristen! Und er hat es nicht mal gemerkt!
Kein Duett im Karaoke-Puff, keine Matratzen-Aerobics morgen
Abend.... Seine Enttäuschung ist riesengroß, aber unser
Mitgefühl hält sich in Grenzen.
Obwohl Vietnam, im Gegensatz zu den
anderen Ländern Südostasiens, Stäbchen benutzt und in Baustil,
Speisekarte, Sprache, Religion und Mentalität den starken chinesischen Einfluss nicht
verleugnen kann, ist es das einzige Land dieser Region, das
Lateinschrift verwendet; die heutige Generation kann die
chinesischen Inschriften an den Tempelhallen und auf den
Tuschebildern ihrer Vorfahren nicht mehr lesen.

Versuche, aus
chinesischen Zeichen eine eigene Schrift zu entwickeln, erwiesen
sich als zu kompliziert, so dass die französischen Missionare,
die zwischen Annam und Tongking die Lateinschrift einführten,
ihre Schreibweise als bis heute verbindliche Schrift durchsetzen
konnten.

"Haarschnitt
gefällig?", fragt lächelnd die junge
Frau aus dem straßenseitig offenen Barbierladen, mit dem Finger
auf mich deutend. Sie hat ja Recht, nach mehr als zwei
Reisewochen sehe ich ziemlich struppig aus, und wenn wir mehr
Zeit hätten, würde ich mich gerne mal von zarter
Vietnamesinnen-Hand aufpeppen lassen, aber am Vormittag hatten
wir zu lange über die endlose  Warteschlange
vor dem Onkel-Ho-Mausoleum und über die Erdbebensicherheit der
One-Pillar-Pagode meditiert und müssen nun zusehen, dass wir
heute noch die Halong-Bucht erreichen.
Warteschlange
vor dem Onkel-Ho-Mausoleum und über die Erdbebensicherheit der
One-Pillar-Pagode meditiert und müssen nun zusehen, dass wir
heute noch die Halong-Bucht erreichen.
Über
eine schnurgerade vierspurige Autobahn rollt das Vehikel flott
auf die Hafenstadt Háiphòng zu, und der Blick aus dem
Autofenster fällt auf eine Landschaft, die ohne weiteres in die
Poebene passen würde, irgendwo zwischen Pavia und Parma, aber
der Fluss heißt Sông Hô'ng, der Rote Fluss, und bei genauerem
Hinsehen spiegeln sich die vielen Kirchtürme nicht im Po,
sondern in Lotosteichen, und die Kneipen am Wegesrand sind keine
Pizzerias oder Espresso-Bars, sondern preisen das lokale Fassbier
an oder bieten entsetzlich kitschige Souvenirs feil.
Die
Halong-Bucht ist von der UNESCO in die Liste der
Weltnaturdenkmäler aufgenommen worden, und das zu Recht. Die
ganze, weite Bucht ist voller Inselchen, die wie Stiftzähne
felsensteil aus dem klaren Wasser ragen, oben mit einem grünen
Dschungelhäubchen bedeckt. Vom Ufer aus sieht das Panorama zwar
genügend fotogen aus, aber wer eigens bis nach Vietnam gereist
ist, wird nicht nach zwei Schnappschüssen wieder abreisen. So
schippert man in einem der zahllosen Ausflugsboote an einem
herrlich sonnigen Morgen los, um Halong vom Wasser aus zu
genießen, eine wunderbare fünfstündige Tuckerfahrt auf ruhigem
Gewässer --- so weit jedenfalls die Theorie. In der Praxis sieht
es schon ein wenig anders aus, nur das Wetter und das
Seafood-Menü an Bord hielten, was versprochen worden war. Der
Rest war ziemlich echt Asien. 
Ein
Profi-Lächler am Hafen
geleitet uns an Bord eines Schiffes, das 60 Passagieren Platz
bietet. Ringsumher dümpeln weit kleinere Nussschalen, bis zur
Reling gespickt mit Busladungen von Touristen. Nun glaubst du,
unser Luxusliner füllte sich langsam mit weiteren Fahrgästen?
Aber nein, die 6 Mann Besatzung machen die Leinen los und
schippern niemanden als uns beide in dem Riesendampfer auf die
blaue See hinaus.
"Nein,
nein, wir verlangen doch keinen Aufpreis", beruhigt man
mich; das Ticket hatten wir ohnehin schon vorher am
Kassenhäuschen erworben. "Ist doch bequemer, viel Platz
für sich zu haben, oder? Aber dafür können wir leider nicht
ganz so lange fahren."
Aha,
da lag der Mops begraben. Die fünf Stunden lustige Seefahrt
schrumpften auf nur 3½, aber kaum hatten wir es uns an Deck in
den Liegestühlen gemütlich gemacht, rumpelte der Kahn an die
Mole der allerersten Insel, und wir durften an Land gehen. Vom
Bootssteg führt ein steiler Pfad in den Dschungel; zu
besichtigen ist "eine außerordentlich schöne Grotte",
die allerdings eher ein außerordentlich schöner Flop war. Wer
noch nie einen Berg von innen gesehen hat, den mag diese
kunterbuntig illuminierte Touristenschleuse vielleicht reizen,
aber die Höhle besteht nur aus einer einzigen großen Halle mit
einigen grobschlächtigen, längst mausetoten Stalaktiten, und
alle Wände in Reichweite sind mit Grafitti bekritzelt, während
der betonierte Gehweg von Unmengen schwitzender und schwatzender
Chinesen verstopft ist, ein wahrer Leiberstau, denn alle 186
Ausflugsboote von Halong fahren offenbar gleichzeitig ab und
nehmen die gleiche Route. Eine geschlagene Dreiviertelstunde
dauert es, bis wir uns durch den Besucherknäuel auf den schmalen
Bergpfaden wieder zum Hafen zurückgekämpft haben, total
vergeudete Zeit.

Als
könne er Gedanken lesen, nahm der Käpt'n danach eine andere
Route als die Touristenflottille, so dass wir tatsächlich Stille
und Natur genießen konnten, aber dafür waren die Inseln, die
wir zu sehen bekamen, nur niedrige, eintönig grün bewachsene
Höcker; die spektakulären Felszinken, die wir sehen wollten,
die wachsen in der entgegengesetzten Ecke der Bucht. Gewiss hatte
es einen tieferen Sinn, uns hier absichtlich zu langweilen, denn
das Deck füllte sich allmählich mit Waren, die in
unerschöpflicher Fülle aus dem Gedärm des Kutters
heraufgetragen wurden. Seidenkimonos, Tuschegemälde,
Ansichtskarten, Taschenbuddhas, was immer wir auch anderswo
bereits mit Entsetzen gemieden hatten, wuchs sich zu einem
Trödelmarkt aus, der malerisch unsere beiden Liegestühle
umrahmte. Wir wollten die guten Leute nicht vergrätzen und
griffen zu, als uns kalte Getränke offeriert wurden, aber um
Kitsch zu verkaufen, hätten die Schiffer lieber eine
Hundertschaft Chinesen an Bord hieven sollen. Eines steht fest:
Uns vergnüglich durch die Bucht zu schippern, war für diese
Boatpeople eine lästige Pflicht; ihr Hauptanliegen war, aus uns
so viele Penunzen herauszuholen wie möglich.
Unser
Trost war das artige Mittagsmahl, das einzige Highlight der
Fahrt,  obwohl als
10. Gang noch ein letzter, wenn auch vergeblicher Versuch
erfolgte, uns zum Erwerb von Glasperlen und bunt bedrucktem
Kattun zu bewegen.
obwohl als
10. Gang noch ein letzter, wenn auch vergeblicher Versuch
erfolgte, uns zum Erwerb von Glasperlen und bunt bedrucktem
Kattun zu bewegen.
❀
Huê',
die alte Kaiserstadt, spiegelt sich im Abendlicht im Perfume
River (Sông Hu'o'ng), auf dem Sampans und heimkehrende
Touristenkähne goldene Furchen ziehen, während der Lichtschein
der Uferrestaurants vor der angestrahlten Kulisse der Zitadelle
den Flusslauf wie ein sternfunkelndes Band begleitet. Mehr als
die Zitadelle, über der eine riesige rote Fahne weht, hat der
Vietnam-Krieg leider von der einstigen kaiserlichen Palastanlage
nicht übrig gelassen, der Rest ist plattgebombter Unkrautacker,
auf dem die Bauten 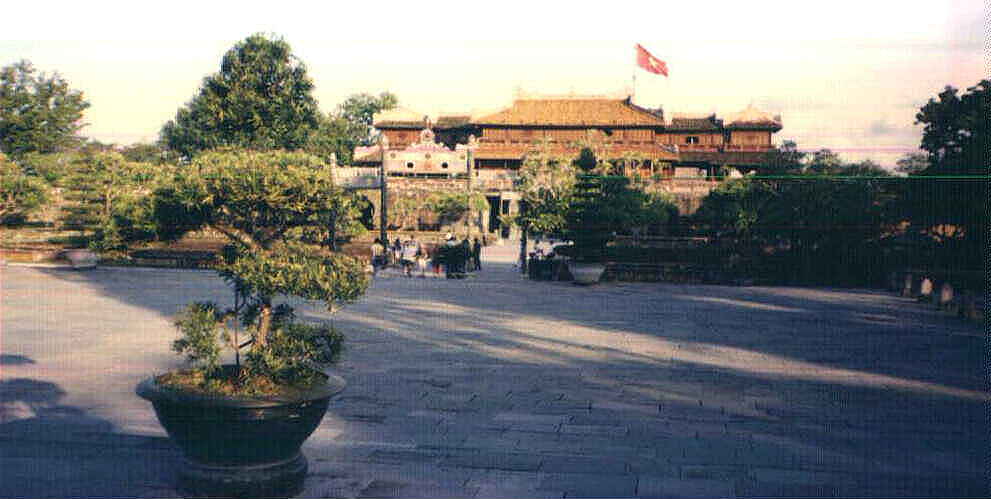 jedoch nach
und nach rekonstruiert werden.
jedoch nach
und nach rekonstruiert werden.
Außerhalb
der Stadt liegen zahlreiche Kaisergräber und die berühmte
Thiên Mu-Pagode, Symbol von Huê' und von Vietnam. Zu erreichen
sind die Sehenswürdigkeiten fast alle mit dem Flussboot, und
dass alle Boote, ja selbst die Fähren, die dich in nur
zweieinhalb Minuten auf die andere Seite des Flusses bringen,
voller Teakholz-Elefanten, Seidenpyjamas und anderem Talmi sind,
der jedem Fahrgast von Ehefrau, Mutter, Großmutter, Töchtern,
Söhnen und Enkeln des steuernden Schiffers  ununterbrochen aufgedrängt
wird, so dass man kaum die Landschaft betrachten kann, versteht
sich in diesem Händlerreich von selbst. Selbst Kleinkinder, die
gerade erst laufen und sprechen gelernt haben, halten die Pfote
auf und leiern das vietnamesische Nationalmantra herunter:
ununterbrochen aufgedrängt
wird, so dass man kaum die Landschaft betrachten kann, versteht
sich in diesem Händlerreich von selbst. Selbst Kleinkinder, die
gerade erst laufen und sprechen gelernt haben, halten die Pfote
auf und leiern das vietnamesische Nationalmantra herunter:
"Moneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoney...."
Die
Nationalstraße Nr. 1 führt nach Süden, oft an der Küste
entlang, aber noch öfter durch bergiges Land, wo sich die Piste
an schlappgemachten Überlandbussen vorbei in Spitzkehren über
die Pässe schraubt. Nationalstraße Nr. 2 ist noch im Bau: Mit
japanischen Investorengeldern wird der Hochiminh-Pfad derzeit in
eine vierspurige Autobahn umbetoniert und in Kürze nur noch
nostalgische Historie sein. Die Vietnamesen sind begeistert von
allem, was sie als fortschrittlich ansehen. Sogar die USA haben
in Vietnam mächtig gepunktet, seit viele ehemalige Flüchtlinge,
die einst auf einem morschen Kahn als Boatpeople das Land
verlassen hatten, nun mit Nike-Schuhen, US-Pass und amerikanisch
knarzenden, mcdonald-dicken Kids die alte Heimat besuchen, in
Luxushotels mit Swimmingpool residieren, in  Firstclass-Restaurants
schlemmen, mit Dollars um sich werfen und die Verwandtschaft belächeln, die sich
noch immer in den Reisfeldern krumm arbeitet.
Firstclass-Restaurants
schlemmen, mit Dollars um sich werfen und die Verwandtschaft belächeln, die sich
noch immer in den Reisfeldern krumm arbeitet.
"Letztes
Jahr war der US-Präsident Clinton hier und ist in Hànôi
herzlich empfangen worden," prahlte der Taxifahrer, aber der
Clinton hat hier zu Lande gut Hände und Kinder drücken,
schließlich hat er sich vor dem Vietnam-Krieg gedrückt.
Vom
Pass herab rollen wir nach Ðànãng hinein, ein Städtchen mit
mediterranem Einschlag, dessen im "amerikanischen
Krieg", wie es hier heißt, zu Schrott gebombter
Marinestützpunkt, im Gegensatz zu der Palastanlage in Huê',
längst wieder aufgebaut und funktionsfähig ist. Wie vor
Jahrzehnten bollern auch heute noch zahlreiche US-Army-Trucks
durch die  staubigen
Gassen: Beutegut, das jetzt, zum Sozialismus bekehrt, auf seine
alten Tage dem Volke dient.
staubigen
Gassen: Beutegut, das jetzt, zum Sozialismus bekehrt, auf seine
alten Tage dem Volke dient.
Aber
wir halten uns nicht lang in Ðànãng auf; nur dem Cham-Museum
mit wahrhaft drolligen, listig schmunzelnden Figüren
hinduistischer Tradition, die das mit den Khmer verwandte
Cham-Volk verehrte, widmen wir ein paar Stunden. Uns zieht es
mehr ans Meer, nach Hôian. In diesem Fischerdorf ist
augenscheinlich die Zeit stehen geblieben, vermutlich im
19.Jahrhundert. Der Dollar ist allerdings auch hier nicht
unbekannt, denn während des vorzüglichen Dîners auf einem
Flussboot-Restaurant waren wir überwiegend damit beschäftigt,
circa 20 ambulante Kitschhändler abzuwimmeln. Und bei Tageslicht
wird deutlich, dass die uralten Häuser, die das Dorf zu einer
Art Freilichtmuseum machen, fast ausschließlich Souvenirs
produzieren, wenn auch meist
gehobener Qualität. Hier kann man seinen Aó Ðài (Vietnams
Nationaltracht, jener elegante Hosenanzug mit den schlabberig
weiten Hosenbeinen) erstehen oder zusehen, wie Seidenkokons
gekocht, gesponnen, gefärbt und gewalkt werden, bis ein schicker
Schal draus wird. Wer aber hört, dass Fabrikarbeiterinnen in
dieser Gegend, die sich den ganzen Tag mit wirklicher
Knochenarbeit abplagen, ganze 5 Dollar pro Tag verdienen, weiß,
wie glücklich er ist, in Amerika, Japan oder Mitteleuropa zur
Welt gekommen zu sein und für läppische Schreibtischarbeit
meist
gehobener Qualität. Hier kann man seinen Aó Ðài (Vietnams
Nationaltracht, jener elegante Hosenanzug mit den schlabberig
weiten Hosenbeinen) erstehen oder zusehen, wie Seidenkokons
gekocht, gesponnen, gefärbt und gewalkt werden, bis ein schicker
Schal draus wird. Wer aber hört, dass Fabrikarbeiterinnen in
dieser Gegend, die sich den ganzen Tag mit wirklicher
Knochenarbeit abplagen, ganze 5 Dollar pro Tag verdienen, weiß,
wie glücklich er ist, in Amerika, Japan oder Mitteleuropa zur
Welt gekommen zu sein und für läppische Schreibtischarbeit  in klimatisierten
Büroräumen und mit bezahltem Urlaub gut das Dreißigfache als
Gehalt einzusäckeln.
in klimatisierten
Büroräumen und mit bezahltem Urlaub gut das Dreißigfache als
Gehalt einzusäckeln.
Ein
Abstecher von Ðànãng aus führt in die nahen Berge, die nicht
zu Unrecht "Marmorberge" heißen. Obendrauf wachsen
Kiefern, Tempel und Pagoden, letztere natürlich aus Marmor, und
ringsherum, am profanen Fuß der Berge, wird gemeißelt,
gehämmert, geschliffen und gebohrt, auf dass all der Marmor als
Gartenzwerge und Löwenköpfe ende, als ob sich aus Marmor nichts
anderes als tonnenschwere Souvenirs herstellen ließe.
"Wir
versenden die Waren in alle Welt, kein Problem!", sucht
mich eine resolute, schlanke Dame mit marmornem Lächeln zum Erwerb
eines gigantischen versteinerten Drachens "für den
Garten" zu bewegen. Danke, danke, so Stein-reich mag ich gar
nicht werden und führe außerdem meinen eigenen (Haus-)Drachen
stets mit mir....
 ❀
❀
Ein
junger Schlaks, der in Sàigòn mit uns Englisch praktizieren
möchte, Journalismus und Soziologie an der VHS studiert und sich
als Mr. Ðuc vorstellt, ist platt vor Staunen, als ich ihn frage,
ob sein Name "Deutschland" bedeute.
"Sie
sind aber clever, Sie sprechen wohl gar Vietnamesisch?", fragt er mit tellergroßen Augen. Das leider nicht, Ðuc ist das
einzige Wort der vietnamesischen Sprache, das ich kenne, bin
schließlich selber made in Germany. "Aber Deutsch spreche
ich leider nicht", fügte der angehende Journalist
vorsichtshalber schnell hinzu.
Natürlich
heißt Sàigòn nicht mehr Sàigòn,
sondern vorübergehend Hô
Chíminh, aber da alle Vietnamesen, sogar in Hànôi,
nur von
"Sàigòn" sprechen, bleibe ich auch dabei. Alle
Karlmarxstädte und Stalinleningrads haben sich früher oder
später wieder der Bürde ihrer Paten-Mumien entledigt, und
Sàigòn sieht in jedem Winkel so verrucht-verkommen nach
Sàigòn
aus, dass Hô Chíminh erbleichen würde, wenn er das
sähe.
Dafür ist es aber, besonders im Chinatown-Viertel Cho'lôn,
eine richtige, herzhafte Stadt voller Kaufhäuser, Geschäfte,
Boutiquen, Bars und Restaurants, wo man auch schon mal eine halbe
Stunde herumlaufen kann, ohne von irgendwelchen Leuten um Dollars
angezapft  zu werden.
Hier kriegt man von einem beflissenen chinesischen Händler, ni hao ma, das
zerschlissene Uhrarmband ersetzt, xiexie, macht $
2.50, zaidian, und dann
hockt man sich in eine ambulante Straßenküche, löffelt
Nudelsuppe und knuspert Hühner-Chopsuey, macht auch $ 2.50,
bevor man sich todesmutig in die Zweiradkavalkaden stürzt, um
den ununterbrochen beknatterten Boulevard zu überqueren; wenn
man berechenbar, ohne nach rechts oder links zu schauen, in
stetem Trott über die Gasse geht, geschieht das Wunder, dass der
zweitaktqualmige, reißende Strom einen sanften Bogen um dich
macht, als seist du eine Insel, und man hat beinahe noch Muße
dabei, sich über die jungen Mädchen zu wundern, die ihre Mopeds
so vermummt reiten, als seien sie alle zum Islam konvertiert.
zu werden.
Hier kriegt man von einem beflissenen chinesischen Händler, ni hao ma, das
zerschlissene Uhrarmband ersetzt, xiexie, macht $
2.50, zaidian, und dann
hockt man sich in eine ambulante Straßenküche, löffelt
Nudelsuppe und knuspert Hühner-Chopsuey, macht auch $ 2.50,
bevor man sich todesmutig in die Zweiradkavalkaden stürzt, um
den ununterbrochen beknatterten Boulevard zu überqueren; wenn
man berechenbar, ohne nach rechts oder links zu schauen, in
stetem Trott über die Gasse geht, geschieht das Wunder, dass der
zweitaktqualmige, reißende Strom einen sanften Bogen um dich
macht, als seist du eine Insel, und man hat beinahe noch Muße
dabei, sich über die jungen Mädchen zu wundern, die ihre Mopeds
so vermummt reiten, als seien sie alle zum Islam konvertiert.
"Hier
sind in Kino und Fernsehen lauter japanische Filme zu
sehen", erklärt uns Freund Ðuc. "Und die japanischen
Schauspielerinnen haben alle so weiße Haut, das ist jetzt das
Schönheitsideal der Jugend von Sàigòn. Ein amerikanisches
Gehalt, eine japanische Frau, ein......"
Zum
14. Mal lassen wir das indochinesische Glaubensbekenntnis über
uns ergehen, das sich im kapitalistischen Thailand, im
buddhistischen Laos, im royalistischen Cambodia und im
sozialistischen Vietnam um keine Silbe unterscheidet. Vietnamesen
sind allerdings noch frei von jeglichem Argwohn, dass die
makellos weiße Haut japanischer Schauspielerinnen ein Produkt
der Makeup-Chemie sein könnte. Japanerinnen, die mit
Feuerstühlen über die Chausseen brausen, tun dies im Hochsommer
jedenfalls ohne Strohhut, Sonnenbrille, Mundschutz, schulterlange
Handschuhe und Leggings, die in Sàigòn als unabdingbare
Accessoires der mobilen Lady gelten und keinen Fitzel Haut der
Sonne aussetzen.
Abends
schleichen wir uns aus dem Luxushotel, in das uns die
Reisebüroleute gesteckt haben, mit unseren vor Schmutz
starrenden Jeans und ausgelatschten Turnschuhen in Gegenden, die
mehr zu uns passen. Da ist an einer belebten Kreuzung ein hell
erleuchteter Biergarten, mit bunten Glühbirnchen um die Veranda,
von der es einladend lärmt, und nach einer nur kurzen
Anfangspanik angesichts der unverhofft hereingeschneiten
Ausländer organisieren die kellnernden Studentinnen mit ihren
verwegenen Miniröckchen die einzige, handschriftlich in englisch
beschriftete Speisekarte des Lokals, die eine erstaunliche Fülle
von Delikatessen preisgibt: Krebs und Garnelen sind nur der
Anfang, Aal und Frosch schon gehobener Standard. Dem
fortgeschrittenen Schlemmer empfehlen sich hingegen Pferd, Hund,
Schlange und Ratte; gegrillte Drachenschenkel, auf die ich gerade
Appetit hatte, waren leider ausverkauft. Am Nachbartisch im
Obergeschoss, mit Blick auf das nächtliche hupende und blinkende
Dauerchaos unter uns, waren fünf Männer mit Schweiß und Fleiß
in prächtiger Laune darum bemüht, den nunmehr zweiten Kasten
Bier in lauwarmen Harndrang umzuwandeln, und der stämmige,
lustige junge Bursche, der drei Brocken Englisch konnte und uns
als Kellner hervorragend betreute, hatte bei jedem Vorübergehen
an dem Säufertisch der bezischten Mischpoke, die inzwischen
fröhliche Gesänge anstimmte, einen Humpen ex zu leeren. Auch
wenn er zusehends Schwierigkeiten bekam, mit dem beladenen
Tablett die steile Treppe fehlerfrei zu bewältigen, herrschte
eine bombige, ansteckende Stimmung in dem Lokal, die auch vor
Sprachbarrieren nicht Halt machte. Als unser netter Boy,
schwitzend und mit biergerötetem Kopf, uns am Ende sogar ein
kostenloses Dessert herbeibalancierte, hatte er sich ein
großzügiges Trinkgeld redlich verdient. Am Kiosk kauften wir
uns noch eine Bottel Wasser, bevor wir wieder in unsere
Nobelherberge schlurften, den indigniert dreinschauenden Lakaien
am Eingangsportal ignorierend, denn ein abgestandenes, aber aus Frankreich importiertes Wässerlein aus dem
Kühlschrank im Hotelzimmer kostet in Sàigòn ebenso viel wie
das gesamte Ratten-und-Frosch-Menü samt Bierschwemme in dem
populären Lokal an der Kreuzung. Irgendwie passe ich nicht in
ein Luxushotel, ich fühle mich da wie der erwähnte Clochard auf
dem Neujahrsempfang des französischen Botschafters.
Drei
Tage Sàigòn, und man träumt von einsamen Atollen mit weißem
Sandstrand,  denn
diese Stadt ist das perfekte Chaos. Nach der
Chaos-Theorie ist genau dies die Voraussetzung für die
Entstehung einer höheren Ordnung. Falls das stimmt, stehen
Sàigòn zweifellos grandiose Zeiten bevor. Leider haben
wir nicht
mehr genug Zeit, um darauf zu warten, sondern sehen zu, dass wir
aufs Land kommen. In Tâyninh, 100 km nordwestlich von
Sàigòn, wohnen seltsam verschrobene Leute, die einem Guru
huldigen,
der Victor Hugo und Sun Yatsen, die beide gewiss ihre Meriten
haben, zu Heiligen erklärte und Buddhismus und Christentum zu
einer neuen Weltreligion verschmelzen will. In weißen Kitteln
streben die Gläubigen täglich um 12 Uhr einer Art von
Kathedrempel zu, wie Ärzte und Krankenschwestern auf dem Weg zur
Kantine. Drinnen singen sie fromme Lieder zu den Klängen einer
buddhistischen Band und preisen Sankt Sunyatsen-Victorügó.
Es
gibt anscheinend keinen Schwachsinn auf dem Erdenkreis, der zu
idiotisch wäre, um gläubige Anhänger zu finden.
denn
diese Stadt ist das perfekte Chaos. Nach der
Chaos-Theorie ist genau dies die Voraussetzung für die
Entstehung einer höheren Ordnung. Falls das stimmt, stehen
Sàigòn zweifellos grandiose Zeiten bevor. Leider haben
wir nicht
mehr genug Zeit, um darauf zu warten, sondern sehen zu, dass wir
aufs Land kommen. In Tâyninh, 100 km nordwestlich von
Sàigòn, wohnen seltsam verschrobene Leute, die einem Guru
huldigen,
der Victor Hugo und Sun Yatsen, die beide gewiss ihre Meriten
haben, zu Heiligen erklärte und Buddhismus und Christentum zu
einer neuen Weltreligion verschmelzen will. In weißen Kitteln
streben die Gläubigen täglich um 12 Uhr einer Art von
Kathedrempel zu, wie Ärzte und Krankenschwestern auf dem Weg zur
Kantine. Drinnen singen sie fromme Lieder zu den Klängen einer
buddhistischen Band und preisen Sankt Sunyatsen-Victorügó.
Es
gibt anscheinend keinen Schwachsinn auf dem Erdenkreis, der zu
idiotisch wäre, um gläubige Anhänger zu finden.
In
derselben Richtung liegt auch Cu'chi, wo der Vietcong die
Amerikaner gründlich geärgert hatte. Bis die GIs nämlich
merkten, dass der Gegner dort unterirdisch agierte, waren viele
schon mausetot. Sie hatten ihr Hauptquartier vor den Toren
Sàigòns ausgerechnet in diesem Gebiet errichtet, das von
Guerrilleros untertunnelt und verhöhlbohrlöchert war wie ein
reifer Gruyère. Wie aus dem Nichts erschienen Vietcong des
Nachts mitten in dem von Stacheldraht und hohen Mauern
gesicherten Camp und spielten den Ledernacken böse Streiche.
Auch nach der Entdeckung der unterirdischen Gänge, die sich, zum
Teil auf 3 Etagen, insgesamt über 200 km erstreckten, hatten die
 Amerikaner
ihre liebe Not mit den einheimischen Maulwürfen: Die großen GIs
blieben mit ihrem sperrigen Gepäck in den engen Gängen stecken,
plumpsten in Bambusspieß- und Sprengfallen oder verfranzten sich
in den stickigen Irrwegen, durch die heute schwitzende Touristen
von wendigen Tunnelführern in Vietcong-Kluft geguidet werden.
Vor dem Einstieg in die Katakomben wird ein Propagandafilm
gezeigt: Friedliche Reisbauern, Kinder in der Schule, Mädchen
beim Tanz, und dann kommen wilde Ausländer ohne Visum, ja sogar
zähnebleckende Schwarze dahergetrampelt, schänden die Tempel und
sprengen Dörfer in die Luft, aber die heldenhaften Vietnamesen
gehen in den Untergrund und bezwingen den teuflischen Feind in
einmütiger Volkssolidarität... --- so einfach
ist das also gewesen mit dem Vietnamkrieg!
Amerikaner
ihre liebe Not mit den einheimischen Maulwürfen: Die großen GIs
blieben mit ihrem sperrigen Gepäck in den engen Gängen stecken,
plumpsten in Bambusspieß- und Sprengfallen oder verfranzten sich
in den stickigen Irrwegen, durch die heute schwitzende Touristen
von wendigen Tunnelführern in Vietcong-Kluft geguidet werden.
Vor dem Einstieg in die Katakomben wird ein Propagandafilm
gezeigt: Friedliche Reisbauern, Kinder in der Schule, Mädchen
beim Tanz, und dann kommen wilde Ausländer ohne Visum, ja sogar
zähnebleckende Schwarze dahergetrampelt, schänden die Tempel und
sprengen Dörfer in die Luft, aber die heldenhaften Vietnamesen
gehen in den Untergrund und bezwingen den teuflischen Feind in
einmütiger Volkssolidarität... --- so einfach
ist das also gewesen mit dem Vietnamkrieg!
In
der Feldküche, 2 Meter unter dem Erdboden, bekommen heutzutage
alle wilden Ausländer, sogar teufelschwarze Afroamerikaner, von
den Fremdenführern eine schlichte, aber kostenlose Vesper:
Original "Vietcong-Food", Tee und frisch gekochte
Tapioka (Cassava-Wurzel). Schmeckte ganz ausgezeichnet, besser
als das Corned beef der US Army womöglich.
"Come
on", sagten wir. Das ist vietnamesisch und bedeutet
"vielen Dank" (càm o'n). Und dann verließen wir das
Land, Vietcong-Food im Bauch, in Richtung "einsames Atoll
mit weißem Sandstrand", wo die Kapitalisten unter sich
sind.



 Ein Backsteinschlot ragt
aus dem palmbestandenen Rondell, um das Taxis und schwere
Limousinen parken, auf Gäste des 25-stöckigen
Fünfsterne-Hotels Horison wartend. Der Fabrikschornstein, der
sich verschämt im Hotel-Swimmingpool auf der Dachterrasse über
der Eingangslobby spiegelt, kommt sich an diesem Ort gewiss so
fehl am Platze vor wie ein Stadtstreicher auf dem Neujahrsempfang
des französischen Botschafters, aber er ist eines der letzten
Erinnerungsstücke an die Zeit, als Hànôi noch die Hauptstadt
des kommunistischen Nordvietnam war, wo Werktätige beim
Stahlkochen und Panzerschmieden den Buckel krümmten, just da, wo
jetzt Gören aus Sachsen und Dakota auf Liegestühlen am Rand des
Pools träge in die Nachmittagssonne blinzeln und an ihrem
Daiquirí schlürfen. Keine Frage, Vietnam hat sich seit Onkel
Hos Zeiten merklich verändert. Aber witzigerweise sieht es
trotzdem aus wie Vietnam: Ein Ozean von hupenden Knatterrädern
durchpflügt rund um die Uhr die mehrspurigen Boulevards, die
allerorts von Straßenhändlern mit dem
Ein Backsteinschlot ragt
aus dem palmbestandenen Rondell, um das Taxis und schwere
Limousinen parken, auf Gäste des 25-stöckigen
Fünfsterne-Hotels Horison wartend. Der Fabrikschornstein, der
sich verschämt im Hotel-Swimmingpool auf der Dachterrasse über
der Eingangslobby spiegelt, kommt sich an diesem Ort gewiss so
fehl am Platze vor wie ein Stadtstreicher auf dem Neujahrsempfang
des französischen Botschafters, aber er ist eines der letzten
Erinnerungsstücke an die Zeit, als Hànôi noch die Hauptstadt
des kommunistischen Nordvietnam war, wo Werktätige beim
Stahlkochen und Panzerschmieden den Buckel krümmten, just da, wo
jetzt Gören aus Sachsen und Dakota auf Liegestühlen am Rand des
Pools träge in die Nachmittagssonne blinzeln und an ihrem
Daiquirí schlürfen. Keine Frage, Vietnam hat sich seit Onkel
Hos Zeiten merklich verändert. Aber witzigerweise sieht es
trotzdem aus wie Vietnam: Ein Ozean von hupenden Knatterrädern
durchpflügt rund um die Uhr die mehrspurigen Boulevards, die
allerorts von Straßenhändlern mit dem  typischen Strohhut und
Bambustragestangen mit zwei überbordend gefüllten Warenkörben
gesäumt sind. Fahrradrikschas, Kolonialvillen, eine im Zentrum
verschimmelnde Kathedrale sowie ein Haufen Leute, die was von dir
wollen. Und was wohl? - Dreimal darfst du raten. Yeah, Dollars
natürlich. Die Amis haben also doch gewonnen.
typischen Strohhut und
Bambustragestangen mit zwei überbordend gefüllten Warenkörben
gesäumt sind. Fahrradrikschas, Kolonialvillen, eine im Zentrum
verschimmelnde Kathedrale sowie ein Haufen Leute, die was von dir
wollen. Und was wohl? - Dreimal darfst du raten. Yeah, Dollars
natürlich. Die Amis haben also doch gewonnen.  einsame
Mädchen beglücken. Ich sehe schon, in Hànôi gibt es
allerhand zu tun, ich werde eine Sekretärin und einen
Bilanzbuchhalter einstellen müssen, um allen Wünschen gerecht
zu werden.
einsame
Mädchen beglücken. Ich sehe schon, in Hànôi gibt es
allerhand zu tun, ich werde eine Sekretärin und einen
Bilanzbuchhalter einstellen müssen, um allen Wünschen gerecht
zu werden.  feuerwerkspeiende Drachen,
Boote, Angler und Mandarine im Puppenformat durch die Brühe, von
den Puppenspielern mit Unterwasser-Stangen bewegt, und nach dem
Schlussapplaus kommen die Künstler hinter den Kulissen hervor,
bis zur Hüfte im nassen Becken watend. Wen die Plantscherei
durstig gemacht hat, der labt sich am lokalen Hopfenbräu Bia Hà Nôi (Bier heißt tatsächlich Bia auf
vietnamesisch), am besten in dem hervorragenden, aber nach
unseren Maßstäben preiswerten De-luxe-Seafood-Gartenrestaurant
Phô Bién, wo es mehr nach Ho-Chi-Michelin-***-Sternen als nach
Sozialismus schmeckt.
feuerwerkspeiende Drachen,
Boote, Angler und Mandarine im Puppenformat durch die Brühe, von
den Puppenspielern mit Unterwasser-Stangen bewegt, und nach dem
Schlussapplaus kommen die Künstler hinter den Kulissen hervor,
bis zur Hüfte im nassen Becken watend. Wen die Plantscherei
durstig gemacht hat, der labt sich am lokalen Hopfenbräu Bia Hà Nôi (Bier heißt tatsächlich Bia auf
vietnamesisch), am besten in dem hervorragenden, aber nach
unseren Maßstäben preiswerten De-luxe-Seafood-Gartenrestaurant
Phô Bién, wo es mehr nach Ho-Chi-Michelin-***-Sternen als nach
Sozialismus schmeckt.  erfahre von diesem
Matratzen-Fachmann, dass die vielen Karaoke-Häuser an den
Ausfallstraßen der City nicht nur Musik, Drinks und Mikrofone
für das Amateur-Gekrächze betrunkener Schlagerfans
bereitstellen, sondern meist auch Hinterzimmer mit Bett; eine
Gefährtin für die Kissenschlacht kann man an der Kasse gleich
dazumieten, das nenne ich neuzeitlichen Service! Die 25 Dollar
für eine junge, langhaarige Schönheit habe er schon beinahe
zusammen, grinst Mr. Nguyên und fasst an die Brusttasche seines
Sommerhemdes, in der ein dickes Bündel Dollarnoten....
erfahre von diesem
Matratzen-Fachmann, dass die vielen Karaoke-Häuser an den
Ausfallstraßen der City nicht nur Musik, Drinks und Mikrofone
für das Amateur-Gekrächze betrunkener Schlagerfans
bereitstellen, sondern meist auch Hinterzimmer mit Bett; eine
Gefährtin für die Kissenschlacht kann man an der Kasse gleich
dazumieten, das nenne ich neuzeitlichen Service! Die 25 Dollar
für eine junge, langhaarige Schönheit habe er schon beinahe
zusammen, grinst Mr. Nguyên und fasst an die Brusttasche seines
Sommerhemdes, in der ein dickes Bündel Dollarnoten....

 Warteschlange
vor dem Onkel-Ho-Mausoleum und über die Erdbebensicherheit der
One-Pillar-Pagode meditiert und müssen nun zusehen, dass wir
heute noch die Halong-Bucht erreichen.
Warteschlange
vor dem Onkel-Ho-Mausoleum und über die Erdbebensicherheit der
One-Pillar-Pagode meditiert und müssen nun zusehen, dass wir
heute noch die Halong-Bucht erreichen. 

 obwohl als
10. Gang noch ein letzter, wenn auch vergeblicher Versuch
erfolgte, uns zum Erwerb von Glasperlen und bunt bedrucktem
Kattun zu bewegen.
obwohl als
10. Gang noch ein letzter, wenn auch vergeblicher Versuch
erfolgte, uns zum Erwerb von Glasperlen und bunt bedrucktem
Kattun zu bewegen.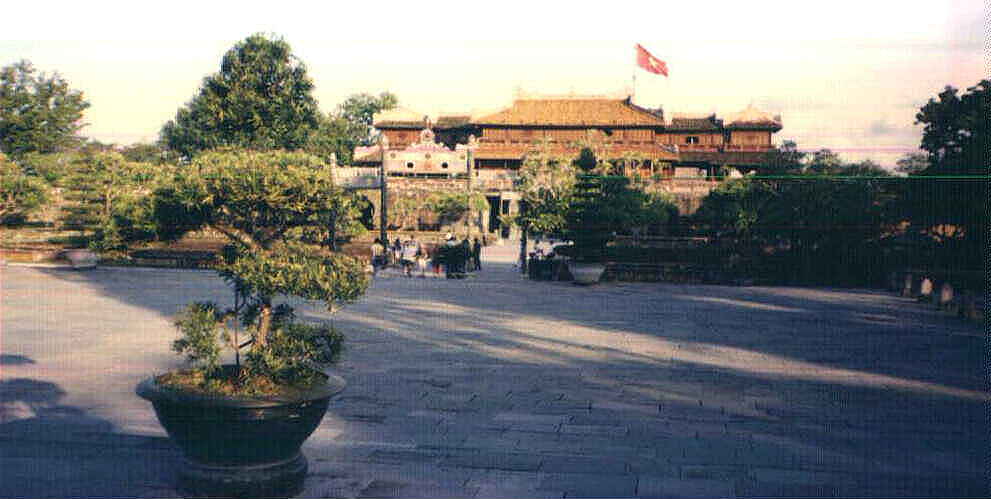 jedoch nach
und nach rekonstruiert werden.
jedoch nach
und nach rekonstruiert werden. ununterbrochen aufgedrängt
wird, so dass man kaum die Landschaft betrachten kann, versteht
sich in diesem Händlerreich von selbst. Selbst Kleinkinder, die
gerade erst laufen und sprechen gelernt haben, halten die Pfote
auf und leiern das vietnamesische Nationalmantra herunter:
ununterbrochen aufgedrängt
wird, so dass man kaum die Landschaft betrachten kann, versteht
sich in diesem Händlerreich von selbst. Selbst Kleinkinder, die
gerade erst laufen und sprechen gelernt haben, halten die Pfote
auf und leiern das vietnamesische Nationalmantra herunter: Firstclass-Restaurants
schlemmen, mit Dollars um sich werfen und die Verwandtschaft belächeln, die sich
noch immer in den Reisfeldern krumm arbeitet.
Firstclass-Restaurants
schlemmen, mit Dollars um sich werfen und die Verwandtschaft belächeln, die sich
noch immer in den Reisfeldern krumm arbeitet.  staubigen
Gassen: Beutegut, das jetzt, zum Sozialismus bekehrt, auf seine
alten Tage dem Volke dient.
staubigen
Gassen: Beutegut, das jetzt, zum Sozialismus bekehrt, auf seine
alten Tage dem Volke dient. meist
gehobener Qualität. Hier kann man seinen Aó Ðài (Vietnams
Nationaltracht, jener elegante Hosenanzug mit den schlabberig
weiten Hosenbeinen) erstehen oder zusehen, wie Seidenkokons
gekocht, gesponnen, gefärbt und gewalkt werden, bis ein schicker
Schal draus wird. Wer aber hört, dass Fabrikarbeiterinnen in
dieser Gegend, die sich den ganzen Tag mit wirklicher
Knochenarbeit abplagen, ganze 5 Dollar pro Tag verdienen, weiß,
wie glücklich er ist, in Amerika, Japan oder Mitteleuropa zur
Welt gekommen zu sein und für läppische Schreibtischarbeit
meist
gehobener Qualität. Hier kann man seinen Aó Ðài (Vietnams
Nationaltracht, jener elegante Hosenanzug mit den schlabberig
weiten Hosenbeinen) erstehen oder zusehen, wie Seidenkokons
gekocht, gesponnen, gefärbt und gewalkt werden, bis ein schicker
Schal draus wird. Wer aber hört, dass Fabrikarbeiterinnen in
dieser Gegend, die sich den ganzen Tag mit wirklicher
Knochenarbeit abplagen, ganze 5 Dollar pro Tag verdienen, weiß,
wie glücklich er ist, in Amerika, Japan oder Mitteleuropa zur
Welt gekommen zu sein und für läppische Schreibtischarbeit  in klimatisierten
Büroräumen und mit bezahltem Urlaub gut das Dreißigfache als
Gehalt einzusäckeln.
in klimatisierten
Büroräumen und mit bezahltem Urlaub gut das Dreißigfache als
Gehalt einzusäckeln.  ❀
❀ zu werden.
Hier kriegt man von einem beflissenen chinesischen Händler, ni hao ma, das
zerschlissene Uhrarmband ersetzt, xiexie, macht $
2.50, zaidian, und dann
hockt man sich in eine ambulante Straßenküche, löffelt
Nudelsuppe und knuspert Hühner-Chopsuey, macht auch $ 2.50,
bevor man sich todesmutig in die Zweiradkavalkaden stürzt, um
den ununterbrochen beknatterten Boulevard zu überqueren; wenn
man berechenbar, ohne nach rechts oder links zu schauen, in
stetem Trott über die Gasse geht, geschieht das Wunder, dass der
zweitaktqualmige, reißende Strom einen sanften Bogen um dich
macht, als seist du eine Insel, und man hat beinahe noch Muße
dabei, sich über die jungen Mädchen zu wundern, die ihre Mopeds
so vermummt reiten, als seien sie alle zum Islam konvertiert.
zu werden.
Hier kriegt man von einem beflissenen chinesischen Händler, ni hao ma, das
zerschlissene Uhrarmband ersetzt, xiexie, macht $
2.50, zaidian, und dann
hockt man sich in eine ambulante Straßenküche, löffelt
Nudelsuppe und knuspert Hühner-Chopsuey, macht auch $ 2.50,
bevor man sich todesmutig in die Zweiradkavalkaden stürzt, um
den ununterbrochen beknatterten Boulevard zu überqueren; wenn
man berechenbar, ohne nach rechts oder links zu schauen, in
stetem Trott über die Gasse geht, geschieht das Wunder, dass der
zweitaktqualmige, reißende Strom einen sanften Bogen um dich
macht, als seist du eine Insel, und man hat beinahe noch Muße
dabei, sich über die jungen Mädchen zu wundern, die ihre Mopeds
so vermummt reiten, als seien sie alle zum Islam konvertiert.  denn
diese Stadt ist das perfekte Chaos. Nach der
Chaos-Theorie ist genau dies die Voraussetzung für die
Entstehung einer höheren Ordnung. Falls das stimmt, stehen
Sàigòn zweifellos grandiose Zeiten bevor. Leider haben
wir nicht
mehr genug Zeit, um darauf zu warten, sondern sehen zu, dass wir
aufs Land kommen. In Tâyninh, 100 km nordwestlich von
Sàigòn, wohnen seltsam verschrobene Leute, die einem Guru
huldigen,
der Victor Hugo und Sun Yatsen, die beide gewiss ihre Meriten
haben, zu Heiligen erklärte und Buddhismus und Christentum zu
einer neuen Weltreligion verschmelzen will. In weißen Kitteln
streben die Gläubigen täglich um 12 Uhr einer Art von
Kathedrempel zu, wie Ärzte und Krankenschwestern auf dem Weg zur
Kantine. Drinnen singen sie fromme Lieder zu den Klängen einer
buddhistischen Band und preisen Sankt Sunyatsen-Victorügó.
Es
gibt anscheinend keinen Schwachsinn auf dem Erdenkreis, der zu
idiotisch wäre, um gläubige Anhänger zu finden.
denn
diese Stadt ist das perfekte Chaos. Nach der
Chaos-Theorie ist genau dies die Voraussetzung für die
Entstehung einer höheren Ordnung. Falls das stimmt, stehen
Sàigòn zweifellos grandiose Zeiten bevor. Leider haben
wir nicht
mehr genug Zeit, um darauf zu warten, sondern sehen zu, dass wir
aufs Land kommen. In Tâyninh, 100 km nordwestlich von
Sàigòn, wohnen seltsam verschrobene Leute, die einem Guru
huldigen,
der Victor Hugo und Sun Yatsen, die beide gewiss ihre Meriten
haben, zu Heiligen erklärte und Buddhismus und Christentum zu
einer neuen Weltreligion verschmelzen will. In weißen Kitteln
streben die Gläubigen täglich um 12 Uhr einer Art von
Kathedrempel zu, wie Ärzte und Krankenschwestern auf dem Weg zur
Kantine. Drinnen singen sie fromme Lieder zu den Klängen einer
buddhistischen Band und preisen Sankt Sunyatsen-Victorügó.
Es
gibt anscheinend keinen Schwachsinn auf dem Erdenkreis, der zu
idiotisch wäre, um gläubige Anhänger zu finden.  Amerikaner
ihre liebe Not mit den einheimischen Maulwürfen: Die großen GIs
blieben mit ihrem sperrigen Gepäck in den engen Gängen stecken,
plumpsten in Bambusspieß- und Sprengfallen oder verfranzten sich
in den stickigen Irrwegen, durch die heute schwitzende Touristen
von wendigen Tunnelführern in Vietcong-Kluft geguidet werden.
Vor dem Einstieg in die Katakomben wird ein Propagandafilm
gezeigt: Friedliche Reisbauern, Kinder in der Schule, Mädchen
beim Tanz, und dann kommen wilde Ausländer ohne Visum, ja sogar
zähnebleckende Schwarze dahergetrampelt, schänden die Tempel und
sprengen Dörfer in die Luft, aber die heldenhaften Vietnamesen
gehen in den Untergrund und bezwingen den teuflischen Feind in
einmütiger Volkssolidarität... --- so einfach
ist das also gewesen mit dem Vietnamkrieg!
Amerikaner
ihre liebe Not mit den einheimischen Maulwürfen: Die großen GIs
blieben mit ihrem sperrigen Gepäck in den engen Gängen stecken,
plumpsten in Bambusspieß- und Sprengfallen oder verfranzten sich
in den stickigen Irrwegen, durch die heute schwitzende Touristen
von wendigen Tunnelführern in Vietcong-Kluft geguidet werden.
Vor dem Einstieg in die Katakomben wird ein Propagandafilm
gezeigt: Friedliche Reisbauern, Kinder in der Schule, Mädchen
beim Tanz, und dann kommen wilde Ausländer ohne Visum, ja sogar
zähnebleckende Schwarze dahergetrampelt, schänden die Tempel und
sprengen Dörfer in die Luft, aber die heldenhaften Vietnamesen
gehen in den Untergrund und bezwingen den teuflischen Feind in
einmütiger Volkssolidarität... --- so einfach
ist das also gewesen mit dem Vietnamkrieg! 

