
≪≪≪≪≪≪ M A D A G A S I K A R A ≫≫≫≫≫≫
August 1992
4

|
In
Richtung
Abendsonne muss der Strand liegen. Auf schmalen Holzfällerpfaden
kommen wir im letzten Abendlicht beim nahen Dorf Ifaty raus. Die
Erwachsenen sind Vazaha wohl gewöhnt, die von den
Strandbungalows herbeigestromert kommen, und die Kinder auch,
aber deren Reaktion ist anders: Während die Malagasy-Mamas vor
der Hütte seelenruhig in ihren Holzfeuer-Kochtöpfen
weiterrühren und den Gruß "Salama" erwidern, kommen
die Steppkes und Bengels allesamt herbeigerannt.
Das
französische Vokabular, das sie alle beherrschen:
"Monsieur,
donnez-moi un cadeau, Madame, donnez-moi de l'argent, donnez-moi
un bonbon, donnez-moi un stylo, donnez-moi, donnez-moi,
donnez-moi...."
So
eine Dauerbettelei
von Leuten, die nicht wirklich in Not sind, sondern lediglich ihr
traditionelles Leben führen wie wir auch, haben wir noch in
keinem Land erlebt. Nicht nur Kinder stimmen angesichts von
Ausländern sofort ihren Donnez-moi-Chor an, sondern
mancherorts
auch etliche Erwachsene, nur haben die ein verfeinertes
Repertoire.
|
|
"Monsieur,
donnez-moi un pourboire", jammert der Pousse-poussist,
obwohl er seinem Gast just einen fünffach
überhöhten Fahrpreis
vorgeflunkert hat, "monsieur, un tout petit cadeau",
bettelt der Hotelbus-Fahrer, der den Gast in seiner Luxuskarosse
für stolze 20000 FMg zum Airport kutschiert hat, obwohl er
später als vereinbart losgefahren, verspätet
angekommen und
unterwegs durch die Mitnahme einheimischer Passagiere um
mindestens 3000 FMg reicher geworden ist. "Donnez-moi
Hustenmedizin, donnez-moi Wehweh-Lutschbonbons", wo immer
der weiße Mann auftaucht, soll er Almosen und Wohltaten
verteilen. Sind da die Missionare dran schuld gewesen, die jeden
Barfüßigen und Halbnackten in christlicher Tradition
als
Bedürftigen missverstanden und mit Rock und Stiefeln versehen
haben? Die Lumpenkinder in Tibet lehnen es lachend ab, wenn man
ihnen was geben will, im Gegenteil, sie schenken dir
buddhistische Amulette; wenn du einem Papua ein Pflaster
aufklebst, rennt er nach Haus und bringt dir umgehend eine Ananas
dafür. Wie kommt es, dass die Malagasy dermaßen
ihren Stolz
verloren haben und alle das Donnez-moi-Lied singen? In Afrika,
so scheint es, wird die europäische Charité als
Macke des
weißen Mannes interpretiert, der auch gratis hilft, spendet
und
zahlt, wenn man ihn richtig zu behandeln versteht und den Bogen
raus hat, einen miserablen Eindruck zu erwecken. Madagaskar ist
keines der afrikanischen Hungerländer; wohlgenährte
Kinder mit
Schleifchen im Haar, in Hemdchen und Röckchen beten
reflexartig
ihr "donnez-moi diesunddas" her, sobald sie ein weißes
Gesicht erspähen; warum sich placken und den Buckel
krümmen,
wenn der weiße Dummkopf auch anders zum Zahlen und Spenden zu
bewegen ist?
|

Donnez-moi, donnez-moi !
|
Aber
die Zeiten sind
vorüber, da katholische Mütterchen warme Pullover
für die nackten Kinder in Afrika strickten oder
die Eskimos in Alaska
mit Kühlschränken versorgten, ohne zu ahnen, dass
auch
Afrikanerinnen stricken können und Iglus keine Steckdose
haben.
Wir werden jetzt zu Erziehern.
"Donnez-moi
un
stylo!" Kommt
ein Bursche auf
uns zu. "Monsieur!" Kommt
ein anderer mit
einer Tasche und geheimnisvoller Miene.
"Monsieur, soll ich Ihnen zeigen, was da drin ist?" Natürlich soll er. Muscheln, zugegeben, schöne, große, blank gewienert und dekorativ. "Kaufen Sie die schönen Muscheln, als Souvenir von Madagaskar!" Unsere Rucksäcke sind voll und schwer. Und essen kann man die Kalkschalen auch nicht. Meine Madagaskar-Souvenirs sind die Eindrücke, Fotos und das Reisetagebuch, aber das ist den Leuten zu abstrakt. Und zu wenig profitabel. Der weiße Massa hat schließlich seinen Daseinszweck verfehlt, wenn ihm nicht die Dukaten aus den Taschen rieseln. |
≪≪≪≪≪≪≫≫≫≫≫≫
|
Wieder einmal Tana, nicht etwa, weil es so schön war, sondern weil alle Wege nach Rom führen, das hierzulande Antananarivo heißt. Eine Schicht urbanen Smogs legt sich auf unseren Sonnenbrand. Drei Tage Tana, und wir sind von den Malagasy kaum noch zu unterscheiden. Was von Vorteil wäre, denn da wäre man in der kapitalen Marktwirtschaft und ihrem Gedränge weniger behelligt. Steht
auf einmal ein
Typ vor dir. "Monsieur, monsieur!", ruft er und fuchtelt mit
einem grünen Zweig herum, auf dem ein Chamäleon hockt
und guckt
wie Jean-Peaul Sartre, ein Auge stiert nach rechts oben, das
andere lugt schräg nach links unten. Das giftgrüne
Vieh sollen
wir ihm abkaufen!? Da muss er uns noch eine Gebrauchsanleitung
mitliefern, denn was sollen wir mit einem schielenden
Chamäleon
anfangen? Legt kein Ei, gibt keine Milch, essen kann man's auch
nicht, Stubenfliegen haben wir keine, rohen Fisch frisst's nicht,
und einen Privatzoo unterhalten wir derzeit auch nicht.
|

Arm sind die Kinder in Madagaskar, aber Not leiden sie nicht
|
Derweil hat ein anderer auf direktere Weise dafür sorgen wollen, dass mir die Dukaten wortwörtlich aus der Tasche rieseln, indem er im Gewühle mit einer Rasierklinge an meiner Umhängetasche herumgeschnitzt hat, wie ich wenig später gewahre. Es wurmt mich gewaltig, nicht allein für reich und gutmütig, sondern auch noch für blöde gehalten zu werden. Wer trägt denn in seiner Tragetasche Bargeld und Juwelen spazieren? Mit den Hotelrechnungen, die sich im Isalo fürs Feueranmachen so gut bewährt hatten und daher in der aufgeschlitzten Außentasche gesammelt waren, kann der Langfing vermutlich nicht viel anfangen, aber die olle Tasche taugt damit endgültig nicht mehr fürs schnieke Tokyo. So ein Blödian. Ist das der Dank der Malagasy, dass wir sie verarzten und mit Spenden überhäufen? Ist das die madegassische Hospitalité, die wir bisher vergeblich suchten?
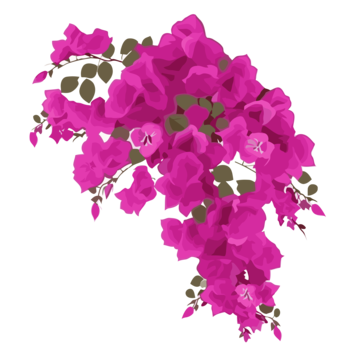 Begeben
wir uns eine
Weile in höhere Sphären, wo die Massas unter sich
sind. In der
Pâtisserie des angeblich sündhaft teuren
Hôtel de France
verwöhnten wir uns mit Naschwerk, das es nur in Tana gibt, und
bei AIR MADAGASCAR sind wir mittlerweile zu VIPs geworden in der
Abteilung für "Clientèle spéciale", zu
der normalen
Sterblichen der Zugang verwehrt ist, auch Ausländern. Wie das? Wir hatten unterdessen schon Vorbereitungen getroffen, Tana auf schnellstem Wege wieder zu verlassen, und zwar in aller Frühe mit dem Überlandbus zur Ostküste. Um halb sechs, es war noch finster, wartete der freundliche, gebildete und fließend français parlierende Taxist, den wir am Vortag zufällig erwischt hatten, wie verabredet vor dem Hotel und fuhr uns zur gare routière, stolz darauf, für seine unverhoffte Zuverlässigkeit gelobt zu werden. Wie oft werden wir wohl noch durch die Schlaglöcher, in Antananarivo so zahlreich wie die Sterne am madegassischen Nachthimmel, rumpeln müssen? |
≪≪≪≪≪≪≫≫≫≫≫≫
|
Dreifaches Erstaunen am heutigen Morgen: Es hat geregnet in der Nacht, der üblicherweise ölhaltige Staub der asphaltlosen Buszentrale hat sich in schwarzpfützigen, ebenso ölhaltigen Schlick verwandelt und sieht aus wie die Wüste von Kuwait im Golfkrieg. Verblüffend ferner, dass wir mit nur 15 Minuten Verspätung davonrollten, obwohl uns beim Eintreffen am Bushafen kund getan wurde, das Fahrzeug sei entzwei gegangen und Ersatz müsse erst organisiert werden. Und die dritte Überraschung: Jeder Fahrgast bekam 2000 FMg zurückgezahlt, weil das Ersatzvehikel enger sei als das kaputte Busch-Taxi. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Vielleicht ist ja heute auch mal wieder ein Glückstag? Was uns bevorsteht, liest sich in den Reiseführern etwa so:"DIE OSTKÜSTE. Tropische Klimazone, üppige Vegetation und dichter Urwald. Während es in den Wintermonaten im übrigen Land kaum je regnet, gibt es an der Ostküste nur zwei Klimazeiten: Die Regenzeit und die nasse Jahreszeit...", undsoweiter blablablaaa... Kann ja heiter wolkig werden, wenn der Regen letzte Nacht die Ouvertüre war für wilde Ost-Schauer. Womöglich muss gar der Parapluie, seit Curepipe angeschimmelt und angerostet, wieder ausgegraben und aktiviert werden? |
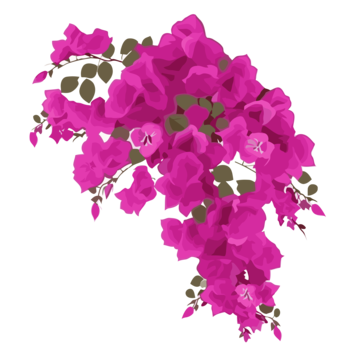
|
Das VW-Bus-große Ersatzmobil macht gewaltig Fahrt. Madegassische Fahrer auf dem Pilotensessel katapultieren ihre Chaussee-Raketen offenbar besonders schnittig über die verkehrsarme Piste, wenn es regenglatt glitscht und gischtet, die Kiste zum Bersten voll ist und in den Dörfern Hunde, Hühner und Kinder in panikartigem Entsetzen Reißaus nehmen. Keine Stunde sind wir denn auch gefahren, da steht ein Haufen Volk am Rande der Chaussee und guckt belämmert in das Reisfeld 10 m unterhalb des Fahrdamms, in dessen Schlamm ihr Sammeltransporter verendet ist. Unser Pilot macht keine Anstalten anzuhalten und zu helfen, streichelt nicht mal andeutungsweise das Bremspedal, sondern trampelt voll auf den Power-Pilz, hupt sich die Bahn frei, und dann Augen zu und durch....! So
tauchte aus dem
nebligen Drizzelregen des kühlen Hochlands kurz nach 9 Uhr
schon
jene ominöse Brücke auf, die, wie Schilder unterwegs
mehrfach
angedroht hatten, nur vor 9, von 12 bis 13 und nach 17 Uhr
passierbar sei, wegen Bauarbeiten an der einzigen Fahrspur. Jetzt
wurde auch klar, warum unser Busdompteur so einen Lemurenzahn
drauf hatte: Die Bauarbeiter hatten schon ihre Brechstangen zur
Hand und sahen wild entschlossen aus, die Brücke zu
demontieren,
aber just bevor sie damit Ernst machten, wutschten wir durch auf
die andere Seite. Der Monsieur auf dem Sitz neben mir murmelte auf
französisch: |

Die Botanik verändert sich allmählich
|
Das
nebelgekühlte Obst
zeigt, dass wir vom Tana-Plateau, wo Kirsch- und Pfirsichbäume
blühen, schon weit heruntergekommen sein müssen, denn
was hier
an Früchten feil ist, gedeiht in subtropischen Breiten. Auch
die
Vegetation ist erheblich palmiger geworden --- nur Urwald ist
nirgendwo zu sehen, bis hinunter nach Brickaville, wo die
Straße
die Ostküste erreicht und dann nach Norden abknickt, in
Richtung
Toamasina. Sicher mag es hier mal Dschungel gegeben haben, aber
die madegassische Fruchtbarkeit ist zu beachtlichen
Menschen-Zuwachsraten detoniert, weshalb Plantagen, Felder und
angepflanztes Grün hier den Urwald nur vortäuschen.
Gewiss, die
Vegetation ist üppig, aber nur wer noch keinen tropischen
Regenwald gesehen hat, fällt drauf rein und glaubt, er stehe
im
Wald. Das buschige Geschling am Pangalanes-Kanal, der sich
parallel zur Küstenlinie in Nord-Süd-Richtung
hinzieht, ist
kaum jungfräulicher als die entschlaftablettene Marilyn
Monroe,
und die exotischen Gewächse auf dem welligen
Hügelland sind
kaum unberührter als die Plumeau-Expertin Madame de Pompadour.
Sogar die malerischen Fächerplamen, die AIR MAD sich zum
Markenzeichen erkoren hat und die hier anmutig die Plantagen
überragen, sind nichts als Edelkokotten unter den baumigen
Dirnen im Pseudo-Urwald, den der Mensch, rodend und kokelnd, zu
willigen Diensten gezwungen hat; da schwelen Köhler-Meiler,
werden Holzkohle, Nutz- und Brennhölzer fabriziert, Bananen,
Papayas und Lychees geerntet und Ölpalmen gehegt. Und wo die
Leute Nutzwald züchten, da müssen die Lemuren
flüchten.
|

Madegassische Fächerpalme
|
Die Perle der madegassischen Ostküste heißt Toamasina; was Le Touquet für Pariser, Brighton für Londoner und Westerland für Hamburger ist, das ist Toamasina für betuchte Antananariver. Die wichtigste Bahnstrecke des Inselreichs verbindet die Hauptstadt mit ihrem Seebad, wo sich Tana-geschädigte, welsche Siedler zu Kolonialzeiten schon ihren Sonnenbrand holten. Wer dem Reiseführer traut und glaubt, die unweit des Busterminals verzeichnete Herberge zu Fuß erreichen zu können, erntet von dem Kordon der Pousseure, die den Rucksack-Menschen umringen, lautes Gelächter. Es sind, der trügerischen Karte zum Trotz, 6 lange Kilometer in einer deutlich anderen Richtung, die auch geübte Poussierer außer Pousste bringen. Das Hotel Miramar, zu deutsch "Seeblick", verfügt über leicht gebaute Chalets, in denen es schon einmal vorkommt, dass ein Frosch auf der Klobrille hockt und dich angrinst, wenn auch du mal austreten willst, und hat einen großen Swimmingpool im Rasengarten, denn der Gast tut gut daran, sich mit Pool und Blick auf den indischen Ozean zu begnügen. Die nähere Bekanntschaft mit dem nahen Meer ist nur extremen Fischliebhabern zu empfehlen, die gerne mal von einem Hai geküsst werden möchten. Diese Raffzähne kommen hier nämlich, von Müll und Touristen angelockt und von keinem Korallenriff gehindert, bis zum Strand und verschmähen angeblich auch bleiche und behaarte Vazaha-Beine nicht. |
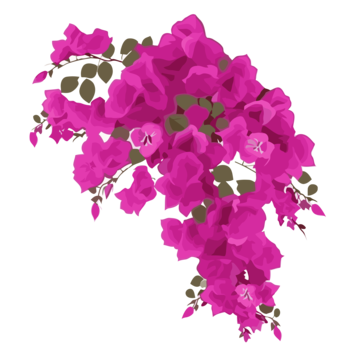
|
Weil alle Straßen der Ostküste als Sackgassen enden, heben wir uns den Genuss des Charmes von Toamasina für den Rückweg auf und erkunden Möglichkeiten, auf die idyllische Insel Nosy Boraha zu gelangen. Reguläre Fährverbindungen gibt es keine, man muss den wöchentlich einmal fahrenden Frachter erwischen, fliegen oder sich von den Fischern in ihren Segel-Pirogen übersetzen lassen. Das kann, je nach Windstärke und Seegang, bei 30 km Entfernung eine ziemlich lustige Seefahrt werden, zumal die Pirogen, günstiger Strömungen wegen, das Wagnis um 3 Uhr morgens in Angriff nehmen. Fliegen? --- Auf Wochen ausgebucht. Frachter? --- 5 Tage warten. Also Piroge??? --- |
Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord......

............einer Piroge.....??
|
Wer wagt, gewinnt. Auf geht's! Manompana heißt das Dorf, wo man die Pirogen-Kapitäne mit ein paar bunten Geldscheinen zur großen Fahrt bewegen kann, liegt 250 km nördlich von Toamasina jenseits des Endes der asphaltierten Chaussee und ist mit etwas Glück und Taxi-Bé vielleicht irgendwie zu erreichen. Der Wagen, dem wir uns anvertrauen, ist ein Peugeot 404 Pritsche; auf der Ladefläche sind zwei Holzbänke montiert, die 8 Fahrgästen Platz bieten, aber erst nachdem 23 Personen reingenudelt waren, setzte sich die Droschke in Bewegung. Ob Weiße auf Malagasy-Frauen besonders sexy wirken? Jedenfalls schloss die üppig geformte, ausnahmsweise kinderlose junge Dame, neben, oder vielmehr auf der ich zu sitzen kam, mich innig in die Arme, drückte mir ihren Busen um die Ohren und wollte, allen Schlaglöchern und Holpersteinen zum Trotz, nimmer von mir ablassen. So saß ich immerhin warm und weich gepolstert, während es Ka hinters Fahrerhäusel verschlagen hatte, wo ihr der steife Fahrtwind die Seele aus dem Leib blies. 85 km lang hatte die tropische Schönheit Muße, an mir herumzuknuddeln, denn die Enge ließ keinerlei Gegenwehr zu. Jedes Strampeln bedeutet einen Tritt in den Bauch eines Mitfahrers, jede Hand- oder Armbewegung in dem unüberschaubaren Leiberknoten kann zum Nasenstüber für den Nachbarn werden oder als unsittliches Befummeln einer der überaus zahlreichen Frauen in dieser rollenden Sardinenbüchse ausgelegt werden. Unsere
Rucksäcke waren
schneller draußen als wir. Als wir uns dem Menschen-Container
und den Umarmungen liebevoller Mitmenschen entzogen hatten,
gewahrten wir zu unserem Erstaunen zwei Knirpse, die unsere
Beutel bereits geschultert hatten und uns angrinsten:
Wo sind die denn
hergekommen? Ringsumher nur Wald und Busch sowie ein Feldweg,
versehen mit einem riesigen Schild:"Wir sind die Träger und Führer!" |
|
** LE RÉCIF ** Bungalows, chalets, plage Cuisine exotique du chef |
|
Mein
Gepäck ist
absolut zu schwer für so einen Dreikäsehoch, ich
trage es
lieber selbst. Andrerseits sollte man es bei den kleinen Kindern
anerkennen, dass sie nicht betteln, sondern sich ihr Trinkgeld
erarbeiten wollen. Bis zu den verheißenen Chalets und
exotischer
Cuisine sind es immerhin ein paar hundert Meter, und an Kas
Huckebeutel haben die Jungs genug zu schleppen.
|
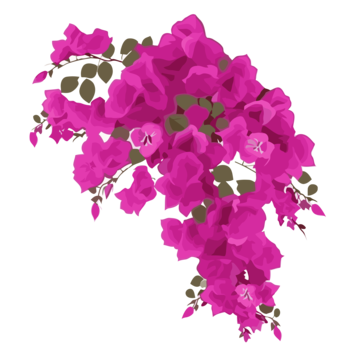
|
Nicht übermäßig comfortable sind die Bungalowchalets im Récif, aber auffallend blitzefunkelsauber. Sogar der Sand vor der Hütte ist glatt geharkt, und zwei Bedienstete im Blaukittel mit langen Spießen in der Hand sind weder Wachsoldaten auf der Abwehr von Mosquitos noch auf der Jagd nach Tintenfischen, sondern hasten jedem zu Boden fallenden Blatt nach, spießen es auf und befördern es zum Komposthaufen. Die Lösung dieses wunderlichen Rätsels, man ahnt es wohl schon: Der Chef des Etablissements ist Schweizer. Na, wenn auch die exotische Cuisine so excellent ist wie die Reinlichkeit in und um unserem Strandhüttli, machen wir hier erst einmal ein Päusli, bevor wir weiterzockeln. Was den Helvetier von den Almen zu den Palmen gelockt hat, war nicht zu ergründen, denn er pflegte sich in seiner "hutte du chef" zu verschanzen, aber die madegassische Madame mit Chefin-Allüren, die das Personal zu nimmer erlahmendem Putzwienern scheuchte, konnte eigentlich nur als Gemahlin eines Schwyzers auf die abstruse Idee verfallen sein, den Sandstrand dreimal täglich mit dem Rechen bearbeiten zu lassen. |

Le Récif, das Schweizer Logis in Madagasikara
|
Im Prinzip sind alle Strände der Welt gleichermaßen vom Meer gesäumt, mit Rändern aus Seetang, Muschelsplitt, Sandkrebsen, Ölschlick und Zivilisationsmüll, den der Ozean als unzustellbar an die Absender zurückspediert. Sogar säuberlich beharkte Strände werden nach einer Stunde Faulenzens ziemlich langweilig, auch wenn die Palmen des Récif wirklich jedem Urlaubsprospekt zur Ehre gereichten. Vom Dösen und Postkartenschreiben hungrig, lechzten wir nach der angekündigten exotischen Cuisine du chef und sehen schon Krebse in Kokossauce paddeln, träumen von Hummersalat auf Ananas oder Muscheln mit Yams-Fritüre, die dem Gourmet die Seezunge rausstrecken, doch als der gelbe Mond wie ein dicker Lampion kopfüber zwischen den Palmen am nachtblauen Südseehimmel baumelte und die Dünung silbrig schimmernd ihre seetangduftende Abendbrise über unsere Teller wehen ließ, da blubberte auf selbigen ein banaler Gulasch auf Reis, mit reichlich Fett am Zebu-Hack, und daneben gab's nur noch ein Tellerli Tomatensalat. Da
nun die leiblichen
Nöte leidlich gestillt sind, will als nächstes der
unersättliche Bildungsdurst gelöscht werden. Noch
einen Tag
lang am Ufer schwitzen und Löcher ins blaue Meer zu gucken,
das
haben wir schon im Moramora
und im Bambou
nicht fertig gebracht. Heftig
werden die Sandalen geschnürt und ein nur wenig
lädiertes
T-Shirt umgehängt, denn heute ist der Tag des Herrn. |
|
Durch
sanft gewellte,
locker bewachsene Heidelandschaft führt der Weg an einem
kleinen
Palmhüttendorf vorbei zur asphaltierten Chaussee, die wie in
Ranohira den Fußgängern gehört. Ein, zwei
Kilometer in
Richtung Toamasina liegt ein größerer Weiler, ein
Marktflecken,
wo wir uns fürs Mittagspicknick versorgen.
|

Dorfmarkt am Sonntagvormittag
|
Die
Leute gucken uns
nur groß an, grüßen freundlich, die Kinder
lachen uns zu, und
niemand stimmt den sonst überall verbreiteten, vielstrophigen
Donnez-moi-Choral an. Eine sympathische Gegend; es gibt
offensichtlich nur wenige Vazaha, die hier zu Fuß durch die
Vegetation streifen und die Sitten der Leute verderben. Immerhin,
Missionare müssen schon hier gewesen sein, denn in einer
Baumgabel hängt neben einem Langhaus eine Bimmel und muss noch
viel wachsen, um eine richtige Kirchturmglocke mit tiefer Stimme
zu werden. Aber Papas mit Schuhen und weißem Hemd, an jeder
Hand
ein Tochterpüppchen mit Schleifchen in den krausen
Löckchen,
mit Rüschenbluse und Faltenröckchen, hier wird der
Sonntag noch
geheiligt! Und schon erschallt ein vielstimmiger Chor aus der
Langhütte und schlägt einen Schwarm entsetzter
Spatzen auf dem
Dach in panikartige Flucht.
|
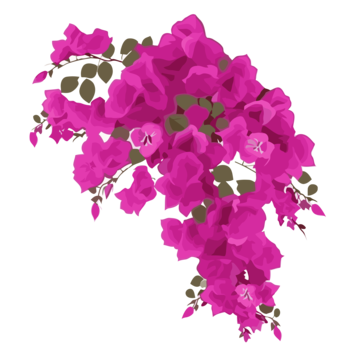
|
Wie
an der Westküste
gibt's viele Pfade durchs Gestrüpp, aber weder bleigraue
Dornbüsche noch rostbraune Baobabs, kein Sand und keine
Dürre.
Hier ist alles erdig-weich unter den Füßen und
saftig grün
ringsumher. Da schmatzen Zebus fetten Klee, da lodern die
Flamboyant-Bäume mit ihren riesigen feuerroten
Blüten,
tratschen Frauen im Palmwedel-Schatten vor ihrer
Palmwedel-Hütte, auf Palmwedeln hockend und Palmwedel-Matten
flechtend. Richtig friedlich, sonnig und schattig zugleich, schon
wieder ein Paradies entdeckt? Es reicht mit den Irrungen auf alternativen Pfaden; wandern wir noch ein paar Meilen auf dem stillen Asphalt im kühlen Abendhauch, der von einer Sonntagsschule jenseits des Tales fröhlichen Kindergesang herüberweht. Mit gemischten Gefühlen sehen wir im Abendrot dem heutigen Dîner im Récif entgegen, denn das gestrige konnte ja auch ein Ausrutscher gewesen sein. Vielleicht hat der brave Schweizer Gardist des Küchenherdes gespart für ein währschaftes Sonntagabend-Mahl. Auf dem Rückweg dunkelte es allmählich, das letzte Stück Weges lag in tiefer Finsternis. Das heißt, nicht ganz: Es begann zu unserer Verwunderung ringsum zu blitzen und zu blinken; Glühwürmchen mit gelben Laternchen irrlichterten über Moor und Wiese, geisterten lautlos durch Dunst und Dunkel und leuchteten uns heim, so gut sie es mit ihren Glimmerlämpchen vermochten. |

Es funkelt in der Dämmerung
|
Ja, und das frugale Abendessen? Ich darf es vorweg nehmen, "cuisine exotique", das galt nicht den Touristen, sondern offenbar den Einheimischen. Für die ist ein biederer Goulaschreis gewisslich arg exotisch, nicht minder das Poulet mit weißen Bohnen oder der fette Schweinebraten mit Erbsen. Wo sonst kann man schon auf Madagaskar Walliser Hausmacherkost genießen? Wir sind wahrscheinlich allzu waldschratige Alternativ-Reisende, dass wir unbedingt den Aal und den Oktopus, die Austern, Shrimps und all die Flossen und Kiemen verkosten wollen, unter denen sich die Stände auf den Märkten biegen. Wer Eintopf unter Palmen mampfen mag, dem sei das Récif wärmstens empfohlen; uns indes ist solche Feinkost zu exotisch, und außerdem wollen wir endlich auf Nosy Boraha gelangen. |
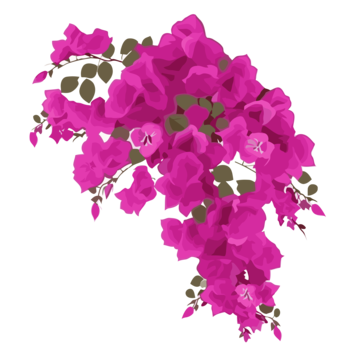
|
Der
Anfang war
keineswegs verheißungsvoll: Eine halbe Stunde verging an der
Landstraße, ohne dass ein wie auch immer geartetes
motorgetriebenes Fahrzeug die paradiesische Stille und reine Luft
behelligt hätte, und was dann dahergetuckert kam, war ein so
abenteuerlich überladenes, auf den Felgen krauchendes
Museumsstück, dass ich darum betete, der Fahrer möge
NICHT
anhalten, um uns mit
reinzupferchen. In der Tat schien er durchaus geneigt zu sein,
auch an uns noch zu verdienen, aber wir nahmen die unbeteiligte
Miene fröhlicher Wandersleut auf der Rast an und
ließen so den
Kelch an uns vorüberknattern. Als wir nach einer geschlagenen
Stunde endlich vom Fleck kamen, steckten wir -- von sitzen
kann keine Rede sein -- in
einem leidlich moderneren Massentransporter, krumm und schräg
zwischen schwitzende Leiber eingeklemmt, und holperten mit
Karacho neuen Aventüren entgegen. Nur wenige Minuten dauerte
es,
da hatten wir jene ächzende Antiquität einge- und
überholt,
die wir zuvor verschmäht hatten.
Zur
heißesten
Mittagsstunde rollte unser Fahrzeug an der Endstation aus, in
Soaniera-Ivongo, wo der Asphalt der beachtlich
schlaglöcherfreien Landstraße am Ufer eines breiten,
braunen
Urwaldgewässers endet. Da gilt es, mit der Fähre
rüberzuschippern, genauer gesagt, auf einem Floß mit
urtümlicher Kraftmaschine dran, aus Zeiten, als der
Außenbordmotor noch nicht erfunden war. Just versuchte ein
voll
beladener LKW, sich dem gebrechlichen Holzgefährt
anzuvertrauen,
und siehe da, er passte drauf, wenngleich das Floß nunmehr
weitgehend UNTER Wasser
schwamm, während die
Gummifüße des Lasters von brauner Brühe
umspült wurden. Wir
neigten dazu, lieber eine Stunde der Rückkunft der
Untersee-Fähre zu harren, an der wir durchaus unsere Zweifel
hatten. Der Blick durchs Fernglas fiel jenseits des Gewässers
auf eine sandige Rutschbahn, die sich das Ufer hinaufwand, um
dann im dichten Busch zu verschwinden. Da, so sprach der Mensch,
der uns hier hergefahren hatte, fahren keine Taxis, weder Bé
noch Brousse. Da muss man per Anhalter oder per pedes
weiterkommen.
|

Erst 46 Passagiere, der Wagen ist ja noch halb leer !
|
Einige
clevere
Bürschlein wussten was Besseres. Sie hätten eine
Piroge, damit
würden sie uns rüberbringen, ja sogar um das Kap
schippern. Von
da aus sind es dann nur noch 17 km zu Fuß bis zu der
Landzunge,
wo die großen Übersee-Pirogen liegen, die zur Insel
übersetzen. Um 6 Uhr seien wir garantiert auf Nosy Boraha.
Klingt verheißungsvoll und verlockend. Wie lange dauert denn
die
Fahrt bis zum désembarque, dem Ausgangspunkt des langen
Marsches? Die Story von dem "um 6 Uhr auf Nosy Boraha" riecht
mir nämlich arg faul. Allein die Überfahrt mit dem
Segelkahn
soll mindestens 3 Stunden dauern, und 17 km Marsch mit Gepäck
über Stock und Stein, das haut einfach nicht hin, so viel
Mathematik hat mir der Pauker am Gymnasium mit großer,
weitgehend leider vergeblicher Anstrengung doch in den harten
Schädel zwängen können.
"Bis
zum
désembarque? Zwei Stunden ungefähr...."
Ich
weiß Bescheid.
Entweder wollen uns die Kerlchen vergackeiern oder uns bis 6 Uhr
MORGENS als Pirogenpilotenpiraten, Führer, Träger,
Sherpas und
Lakaien auf verschlungenen Pfaden und krummen Umwegen ausmelken.
Der wagemutige Laster sucht gerade die Sandpiste am andern Ufer,
das er zu meinem grenzenlosen Erstaunen heil erreicht hat, zu
erklimmen. Von da aus sind es bis Manompana, dem Pirogenhafen,
nur 12 km; und da sollen wir die grinsenden Schlitzohren mit
ihrer Piroschka anheuern, um dann noch 17 km durch die Botanik zu
trappeln? Nachdem ich dann noch hörte, was das freundliche
Anerbieten denn kosten solle, frage ich mich, ob wir vielleicht
mit Abgesandten des Entwicklungshilfe-Ministeriums verwechselt
worden sind, die überflüssige Millionen aus
Steuergeldern an
frierende Afrikaner verteilen möchten.
|

Palmige Ostküste mit Blick auf Nosy Boraha
|
Als die Fähre wieder da war, tat sie einen gurgelnden Laut, und der Stottermotor verstummte. Der Schiffer rödelte sein wertvolles Stück im Uferschilf fest und hub sich von dannen, zum Mittagessen. Da stehste da und machst ein langes Gesicht. Wegen zwei Fußgängern fährt der sowieso nicht, tröstete uns ein Mensch aus der Crew des rückfahrtbereiten Taxi-Bé. Es ist schon fast 13 Uhr, die Sonne brennt aufs Gehirn, das Gepäck drückt auf die Schultern, die Fähre pausiert, und die 12 km drüben ohne Aussicht auf Fortkommen, da sämtlicher Verkehr in unserer Richtung vom Wohlwollen des Fährmanns abhängt, der sich vermutlich gerade zum Mittagsschlaf aufs Ohr legt.... Wir guckten uns an,
grinsten und stiegen dann wie verabredet in den Minibus. Lassen
wir die blöde Insel halt sausen, es gibt auf Madagaskar noch
mehr zu sehen! Noch am gleichen Abend, zwei überfahrene
Küken
und einen plattgemachten Gockel hinter uns wissend, waren wir
wieder in Toamasina und fuhren diesmal nicht per Pousse-pousse,
sondern, schneller und erheblich billiger, per Taxi ins Miramar.
Das einzige Pousse-pousse heute ist der Name des neu
eröffneten
Restaurants für italienische und madegassische Küche
im Zentrum
der Stadt, adrett, hell, nicht teuer und ein paar Fliegen weniger
als anderswo, da lässt sich dem Tag noch ein
versöhnliches Ende
abgewinnen.
|
≪≪≪≪≪≪≫≫≫≫≫≫