
≪≪≪≪≪≪ M A D A G A S I K A R A ≫≫≫≫≫≫
August 1992
3

|
Kein
Löwe, keine
Giraffe, nichts Aufregendes, das der Rede wert wäre;
mühsame
Kraxelei vielmehr, mit dem Rucksack auf dem Puckel, von der
Hochebene runter in die Schlucht, über einen schmalen Grat an
tiefen Abgründen vorüber, dann wieder rauf auf das
nächste
Plateau --- und doch sind wir rundum zufrieden und glücklich,
wenn wir Rast unter irgend einem strubbeligen Gewächs machen
und
eine saure Zitrone auslutschen, vom Höhenwind gezaust und mit
grandioser Aussicht über die Isalo-Wildnis. Hier ist die Welt
wie kurz nach der Schöpfung, als nur 7764 Menschen den Globus
bevölkerten und das Rad, der Walkman, das
Staatsexamen,
der BH, die Lindenstraße und Viagra noch nicht erfunden waren.
|

Um den Grat zwischen zwei Schluchten zu passieren, muss man schwindelfrei sein
|
Jähes
Ende der
Bergeinsamkeit: Vom Tal gellt Gelächter und Holzhackerlaut
herauf. Da ist die tolle Lichtung mit Bergsee, die wir angepeilt
hatten, besetzt von Scharen schwarzer Sherpas, die für ihre
abwesenden weißen Massas Zelte auffalten und in
Riesenkochtöpfen über qualmigen Holzflackerchen
irgend einen
zähen Brei zusammenrühren. Das ist die Mischpoke, die
uns
gestern mit ihren beiden Landrovers eingestäubt hatte. Sie
sind
von Antananarivo aus gekommen und fragen uns daher nicht so
konsterniert nach unseren Guides wie all die Jungs aus Ranohira,
machen aber Gesichter, als hätten wir sie damit, dass wir auch
führerlos bis hierher gelangt sind, tief beleidigt; vermutlich
würden sie uns an diesem Ort nur sehr widerwillig dulden. Wir
haben freilich auch keine Lust, unser Zelt noch mit dazu zu
knäulen, uns vom Kokel dieser Bande einräuchern zu
lassen und
bis Mitternacht Campinglärm zu ertragen; wir beißen
uns durch
das weglose Dickicht im Talesgrund noch 20 Minuten
bachaufwärts
und finden da eine Stelle, an der sich das Rinnsal zu einem
brauchbaren Swimmingpool vertieft und verbreitert, mit Sandstrand
und Vacoa-Palmen, für uns wie geschaffen, wo von anderen
Leuten
nichts zu hören und zu riechen ist. Ungerührt steigen
wir
gleich in die kühle Badewanne, mögen Seife, Pipi und
Shampoo
dem Abendkakao der bachabwärts lagernden Expedition die rechte
exotische Würze verleihen!
|

Badewanne der Natur
|
Am
andern Morgen, als
wir schlaftrunken aus dem Zelt krochen und zur gestrigen
Campingstätte vorschlichen, war dort nur warme Asche und
angeschmorter Müll zu erblicken; die Safari ist auf dem
Rückmarsch, und wir haben das Gebirge für uns allein.
Selbst
wenn auch heute wieder ein Riesentross in den Berg einfallen
sollte, hier kämen sie frühestens am Nachmittag an.
Vosichtshalber ließen wir unser Plastik-Chalet aber an seinem
gut verborgenen Ort in der Wildnis, bevor wir uns heute davon
machten, ohne Rucksack und Pack. Ein halbes Stündchen ins
Nachbartal, wo ein gleichartiges, lauschiges Plätzchen wartet,
aber ohne Müll und Campingspuren. Der schönste je
geschaute
Flecken Erde, und gehört heute nur uns allein! Von herrlichen
Felswänden eingerahmt, blühende Mini-Baobabs hier und
da am
Hang, rinnt im schattigen Tal unter raschelnden Vacoa-Palmen und
blauem Himmel der klarste Bach, den man sich vorstellen kann,
durch saftiges Grün, gluckst emsig zwischen blühenden
Orchideen
und Sumpfgräsern, teilt sich hier, verbreitert sich da,
springt
launisch über ein paar Felsen oder bildet eine metertiefe
Badewanne, in der man noch die Sandkörner auf dem Grund
zählen
kann. Blaugelbe Vögel picken eifrig nach Würmern,
ohne sich an
uns zu stören, rubinrote und türkisblaue Libellen
funkeln über
das kristallhelle Wasser, das sich endlich in einem Felsbassin
staut, zum Schwimmen wie geschaffen, und durch eine schmale
Lücke im Felsen in eine tiefe Schlucht stürzt; wie
tief, weiß
ich nicht, denn der Grund lag in dunklem Schatten. Wir taten
nichts den ganzen Tag als nur zu staunen und uns an der Natur zu
berauschen, und hatten dennoch keine Langeweile. Adam und Eva im
Paradies, für 24 Stunden.
Wer weiß,
wie tief das Abwasser "unseres" Pools in die Schlucht
stürzt
|
 |
|
Wir
wären gern noch
einen Tag geblieben, diese Täler sind attraktiver als die
palmigsten Sandstrände, an denen man doch nichts anderes als
das
Meer vor der Nase hat, und das sieht überall gleich nass aus.
Nur hat ein irdischer Garten Eden den lästigen Nachteil, dass
er
keinen einzigen verbotenen Apfelbaum enthält, geschweige denn
einen Supermarkt oder ein Restaurant. Nur Wasser. So begeisternd
das Örtchen ist, wir haben Proviant nur für
fünf Tage dabei,
und heute ist deren vierter. Alle Kanister mit dem guten
Quellwasser gefüllt, klettern wir wieder über Stock
und Stein
zurück. Den mörderisch steilen Felsberg erklommen wir
noch,
solange er im Schatten lag. Seit vorgestern Nachmittag sind wir
keinem Menschen mehr begegnet, wir waren allein auf der Welt.
Schon gegen halb zwei erreichten wir unsere
Übernachtungsstelle
vom Hinweg, bei der Viehtränke am Fuß des Berges,
und ein
weiteres halbes Stündchen, und wir waren wieder
zurück in der
profanen Welt der lieben Mitmenschen.
|
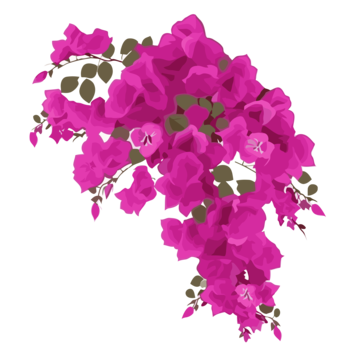
|
Die
erste Begegnung mit
menschlichen Wesen war von der angenehmen Art: Drei Kinder aus
dem nahen Dorf Tameantsoa auf dem Rückweg vom
Wäschewaschen,
zwei Mädchen, beide etwa 15 Jahre alt, und ein vielleicht
8jähriger Bub. Ungeguidete Vazaha zu Fuß, wie
Waldschrate aus
dem Busch hervortappend, sind vermutlich eine gewisse Attraktion,
aber die Kinder starrten uns nicht nur staunend an, sondern
versuchten, sich auf dem Stück gemeinsamen Weges mit uns
anzufreunden. Die Kommunikation endete zwar schnell an der
unüberwindlichen Sprachbarriere, aber das keckere der beiden
Girls mit der Wäsche auf dem Kopf und den zierlich
geflochtenen
Krausezöpfchen, dessen weit geöffnete Bluse ihre
jugendliche
Brust mehr präsentierte als verbarg, wollte unbedingt mit
Kazuko tauschen, Rucksack gegen Wäschebündel.
|

Wäschemädchen mit zierlich geflochtenen Zöpfchen
|
Den
Rucksack gab Ka
nur zu gerne her und nahm das leichtere Wäschebündel
auf
afrikanische Weise auf den Kopf, musste es allerdings gut
festhalten, denn im Kopftransport von Waren sind Afrikanerinnen
eben doch wesentlich geübter. Jedenfalls hatten wir viel
Spaß
miteinander, das lachende madegassische Mädel
mit dem Vazaha-Pack auf dem
Buckel und Ka mit der Wäsche einer afrikanischen
Familie aus Tameantsoa
auf dem Kopf. Unter der ponchoartigen Decke, die das
andere Girl um die Schultern geschlungen hatte, ragten zwei
kakaofarbene Minifüßchen heraus; stolz zeigte sie
uns, was sie
da mit sich herumschleppte, aber ob es ihr Nachwuchs oder ein
Brüderlein war, bekamen wir nicht heraus. Die
Barfuß-Schönheit
mit dem Rucksack lief trotz Last und Hitze flotten Schrittes an
unserer Seite, und als sie zu schwitzen anfing, gaben wir ihr
einen Schluck Bergwasser, und die anderen Kids süffelten auch
alle mit. So waren wir allen Sprachproblemen zum Trotz ziemlich
dicke Freunde geworden, als wir die Abzweigung zum Dorf
erreichten. Die Lasten wurden wieder ausgetauscht, und für
ihren
Fleiß bekam die nette Gepäckträgerin einen
Kugelschreiber und einen rosa
malenden Filzstift. Als wir ihr zeigten, wie man sich damit die
Fingernägel rosa malen kann, geriet sie vor Freude beinahe aus
dem Häuschen. Bis uns die hohen Savannengräser die
Sicht
nahmen, standen die kaffeebraunen Teenies an der Weggabelung,
winkten uns nach und riefen "Veloma, vazaha!" (Lebt
wohl, ihr Fremden)
----
Es gibt Momente, da wächst einem Afrika ziemlich ans Herz. |
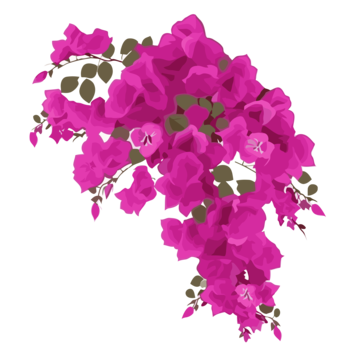
|
Die
zweite Begegnung
mit Malagasy in der fast menschenleeren Savanne fand in der
letzten Oase vor dem langen Rückmarsch nach Ranohira statt.
Dort
hatten wir unser Taschen-Appartement für die
Übernachtung
aufgeschlagen. Gerade köchelte der Tee auf dem
Reisigfeuerchen,
die Sonne war am Untergehen, da tauchten auf einmal wie die
Heinzelmännchen viereinhalb schwarze Gesichter zwischen den
Lianen auf und ließen sich wortlos um uns nieder, als seien
wir
Wanderschausteller, die nun gleich eine Kobra tanzen lassen,
Feuer speien oder Karnickel aus dem Zylinder zaubern. Damit
konnten wir leider nicht dienen, aber Ka empfand Mitleid mit
dem arg grindigen Baby, das die einheimischen Damen dabei hatten.
Sie packte Desinfektionsmittel und Salbe aus der Reiseapotheke
und cremte das Kind tüchtig ein. Vielleicht, so hofften wir,
würden sie uns dann aus Dankbarkeit ein wenig in Ruhe lassen
bei
unserem letzten Abendmahl vor Ranohira. In der Tat zogen sie nach
vollbrachtem Einkrem-Ritual von dannen, aber der Tee war noch
nicht leergetrunken, da waren sie schon alle wieder da und hatten
sogar noch Verwandtschaft im Gefolge: Ein zahnloser Methusalem
und seine faltige Gattin ließen sich vor unserer
Zweimann-Villa
nieder, der Alte wies auf die Uroma, die auf sein Kommando
entsetzlich loshustete und nicht mehr damit aufhörte, bis wir
erneut das Pillenköfferchen auspackten. Da drin gibt's auch
ein
chinesisches Pülverchen aus Drachenschuppen, Einhornzahn,
getrocknetem Hexenblut, Phönixaugen und gestampftem
Galgen-Alraun, das gar nicht übel nach Zimt schmeckt und
Husten,
Schnupfen, Heiterkeit, Legasthenie, Bauchnabelverrostung und
sämtliche sonstigen Zipperlein unfehlbar ausrotten und den
Patienten nahezu unsterblich machen soll. Genau die richtige
Medizin für den vorliegenden Fall, diagnostiziere ich. Brav
wie
eine Volksschülerin öffnete die runzlige Oma den
zahnlosen Mund
und ließ sich beim flackernden Lagerfeuerschein das
Pülverli
reinschütten, trank andächtig und vertrauensvoll
Wasser aus
unserer fast leeren Bottel und vergaß tatsächlich,
weiterzuhusten. Wer hätte geahnt, dass wir auf unsere alten
Tage
noch eine verheißungsvolle Karriere als Medizinmann und -frau
auf Madagaskar vor uns hätten? Ärzte ohne Grenzen....
|

Grenzenlose "Ärztin" mit Patientinnen
|
Der
Opa deutete nun
unter lautem Stöhnen auf seinen Rücken und wollte
auch einen
Lutschbonbon - weißer Mann scheint in den abgelegenen
Dörfern
der afrikanischen Savanne so eine Art lieber Gott zu sein, es
kommen Aussätzige und Sieche, Blinde und Lahme, um
für ein
Dankeschön wieder gehend und sehend zu werden. Und dann wieder
weiterzusündigen wie zuvor....
Wenn
wir noch einen Tag
länger hier blieben, würde unsere ambulante
Buschpraxis zu
einer Wallfahrtsstätte, zu einem zweiten Lambarene, und die
Leute pilgerten in Scharen herbei, um sich gratis ein Säftli
oder Pülverli einflößen zu lassen! Bei den
Papuas würde
jeder wenigstens eine Kokosnuss mitbringen, aber hier kriegen wir
nicht mal eine müde Tomate. Wir machen uns in aller
Frühe aus
dem Staub, bevor die nächsten Patienten vor dem Zelt stehen.
Die
Reiseapotheke ist ohnehin fast leer, die Salbe hat die Tante mit
ihrem Schorf-Baby mitgenommen, die Hustenspezialistin hat eine
Monatsration
Drachenpulver gekriegt und der Alte gab sich erst zufrieden, als
er ein Paket Heftpflaster ergattert hatte. Bei Sonnenaufgang
tippelten wir schon durch Andriamanero, der frühe Aufbruch hat
sich gelohnt: Keine Wolke am Himmel, kein Jeep unterwegs, wir
mussten die über 35 km alle ablatschen, bei brütender
Tageshitze in baumloser Einöde, bergauf und bergab, durch
Staub
und Sand. Als die Gehstrecken kürzer und die Rastzeiten
länger,
das Trinkwasser weniger und die Beine schwerer wurden, erschienen
in weiter Ferne endlich die Kirchtürme von Ranohira. Und vor
meinen Augen eine Fata Morgana: Eisgekühltes Bier im Hotel
"Zu den fröhlichen Lemuren".
|

Die letzten Vorräte köcheln zum Mittagsmahl in der Savanne
|
Bis
es so weit war,
schien der Vollmond; unter Sternenhimmel krochen wir nach
Ranohira rein. Der Lemurenwirt war froh, seine Wolldecken und
zahlenden Gäste wieder zu haben, seine Gattin tischte einen
besonders dicken Topf voll Nudelsuppe auf, und ich schüttete
eisgekühltes Bier in mich rein wie ein Altbayer. Wie sehen aus
wie gebrannte Mandeln, haben erste Blasen an den
Füßen, sind
dreckig wie die Luft von Antananarivo, fressen und saufen wie
Zuchtstiere und schnarchen um 9 Uhr schon im Tiefschlaf, ohne was
von dem Tohuwabohu zu hören, den die Dorfjugend an Wochenenden
bis zum Morgengrauen veranstaltet.
|

Wem das Gras über den Kopf wächst
≪≪≪≪≪≪≫≫≫≫≫≫
|
"Pousse-pousse, Monsieur, pousse-pousse!" Der Bus steht noch
nicht richtig am Terminal von Toliara, da raufen sich die
Rikscha-Jungs schon fast um die zwei Ausländer. Na
schön,
lassen wir uns mal poussieren, vom Herumtippeln mit Gepäck
haben
wir vorerst genug. Aber der Knabe, der uns gleich bescheißen
will und für die 500 m bis zum Hotel Capricorne 3000 FMg
verlangt, muss sich andere Dumme suchen; ich weiß, dass 500
FMg
hier der Einheitstarif sind und nehme eine andere Schubkarre. Die
Pousse-pousse-Fritzen haben es besonders auf die Weißen
abgesehen. Vor Banken, vor der Agentur von AIR MADAGASCAR, vor
Hotels und Restaurants ballen sie sich und lauern auf Kunden.
Nicht dass Einheimische die Schiebemobile nicht benutzten, aber
Weiße lassen sich entweder übers Ohr hauen oder vom
Anblick des
schwitzenden Schiebers in seinem löcherigen Hemde erweichen
und
geben noch ein Aufgeld. Hinzu kommt, dass es in den Augen der
Malagasy nur Geiz sein kann, wenn sich ein Ausländer,
außer ums
ins Bett oder aufs Klo zu gelangen, seiner eigenen Beine bedient.
Ein cleverer P-P-Pilot folgt dir den ganzen Vormittag mit seinem
Rollsofa, von der Bank zum Schreibwarenladen, von der Post zum
Café und zum Markt, wohl wissend, dass der Fremdling in
einem
Weiler von der Größe Toliaras schwerlich den ganzen
Tag
spazieren gehen wird. Spätestens am Mittag hat auch der
dickfelligste Tourist ein Einsehen und lässt sich zur Mahlzeit
in sein klimatisiertes Nobelhotel chauffieren. Beim Aussteigen
versucht der Pousseur, noch was rauszuholen aus dem weißen
Wandergeldsack:
"Monsieur, donnez-moi un petit cadeau, un pourboire...!", jammert er mit tieftraurigen Hundeaugen. |

Lass dich mal poussieren.... - Pousse-Bahnhof in Toliara
|
In unguter Erinnerung an die Summe, die uns die Moramora-Leute für den Transfer berechnet hatten, obwohl sie ohnehin täglich zweimal oder mehr nach Toliara rattern, um Wasser zu holen und Einkäufe zu erledigen, suchten wir uns ein anderes Transportmittel. Sollense doch leer durch die Sanddünen mahlen, wir stehen an der Buschtaxi-Station und warten, ob sich in unserer Richtung was bewegt. Man muss sich freilich vor Augen halten, dass selbst auf Magistralen wie der Nationalstraße Nr. 2/3 von Antananarivo nach Toliara so wenig Verkehr ist, dass die Straße, in Ranohira beispielsweise, als Marktplatz, Spielplatz, Tanzdiele und Versammlungsort dient. Wenn da einmal, beide Richtungen zusammengenommen, 30 Automobile am Tag vorüberkommen, ist das viel. Es gibt Gebiete, wo Autos trotz Asphaltstraße so selten sind, dass alle Leute ausnahmslos in den Graben springen und das Vehikel streng mustern, das da frech einhergeknattert kommt. So herrscht auch an der Buschpisten-Abfahrtsstelle von Toliara nicht gerade ein hektisches Kommen und Gehen. An Pousse-pousses, Marktgewusel und Kindergeplärr hingegen mangelt es weniger, denn viele Einheimische mit Säcken und Päcken warten geduldig, bis innerhalb der nächsten Stunden vielleicht ein wagemutiger Wüstenkreuzer auftaucht. Wir
wollen unseren
restlichen Urlaub nicht im Müllgürtel von Toliara
verbringen
und nehmen daher, ohne lang zu wählen, das erstbeste
Gefährt,
das in unsere Richtung rollt: Ein Lastwagen mit überdachter,
leerer
Ladefläche. Längs der Küste wird viel
Baumwolle angebaut, und
der Camion hatte wohl gerade eine Watte-Ladung in die Stadt
gebracht; die Flocken, die dem Gefährt auch nach der Entladung
in Fülle anhafteten, hatten in kürzester Zeit alle
auf dem Deck
aufsässigen Fahrgäste in Hemd und Haaren. Wegen des
Fahrpreises
gab es allerdings nach 2 km Holperfahrt offenbar ernstliche
Differenzen zwischen dem kassierenden Kopiloten und zwei
älteren
Herren. Mitten in der Wüste machte der Wagen Halt; der Fahrer
stellte den Motor ab, und dann kam ein deftiges afrikanisches
Palaver in Gang, dass die Baumwollflocken nur so flogen. Ich
hätte gern ein bisschen Malagasy verstanden, denn das
Wortgefecht war für die Mitreisenden eine Riesengaudi, sie
folgten gespannt jeder Wendung, als handle es sich um die
Übertragung eines
Meisterschafts-Endspiels. Nach 20 Minuten war der Fall
ausdiskutiert, der Camionist brachte die Maschine in Gang und
rumpelte mit Karacho, dass die Leute an Bord umherkullerten wie
reife Wassermelonen, durch die dürre Vegetation. Die Strecke,
die das brave Moramobil in zwei Stunden bewältigt,
durchpflügte
unsere Donnerwalze in nur 50 Minuten, Schlaglöcher und
Felskanten souverän ignorierend. Ein Eisenrohr, das die Plane
stützte, brach bei der Wotansjagd ab und krachte zwischen die
krampfhaft Halt suchenden Opfer des wie gedopt pesenden
Camion-Schinders, glücklicherweise ohne jemanden zu
erschlagen,
und im Handumdrehn und für nur 5000 FMg standen wir wieder
einmal vor dem vertrauten Schild mit der Inschrift:
|
| ↢ MORA
MORA |
|
"Le Bambou"
heißt eine Strandbungalow-Anlage, keine 300 m vom Moramora entfernt, funkelnagelneu,
beinahe eine Kopie des Nachbarn, aber zu weniger als dem halben
Preis. Da lässt es sich wohl sein und die matten Knochen nach
dem langen Marsch von Isalo ausruhen. Schließlich sind wir
nicht
mit dem teuren Moramora verheiratet und gehen
fremd,
wenn es die gleiche Leistung auch billiger gibt. Wir sind
allerdings keine Strandhocker, und zum Baden ist die
madegassische Westküste auch kaum geeignet: Wenn es am
heißesten ist, liegt nur Schlick vor der Türe; das
Meer zieht
sich zur Ebbe bis zu den fernen Korallenriffs zurück, die den
Strand vor Haien schützen. Vor 8 Uhr morgens und nach 4 Uhr
nachmittags, wenn man reinhoppen könnte, ist die Brise
aber kühl wie auf Norderney.
|
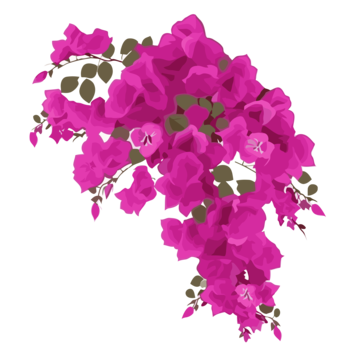
|
So stapft der deutsche
Wandervogel schon gleich wieder durchs Gehölz, vom
grünen
Filoa-Hain und den Wellensittich-Schwärmen gelockt, die in den
hohen Bäumen ein kreischendes Vogel-Palaver halten. Von Bambou
freilich keine Spur, die Unterkunft hätte sich besser "Le
Kaktüs" genannt. Aus dem Wiesengrund führt ein Pfad
durch
knöcheltiefen, rotbraunen Sand in einen wahren Kakteenwald,
und
die mit Flechten und Lianen überwachsenen
Stachelgewächse ragen
baumhoch in den blauen Himmel.
|

Kakteenwald bei Ifaty
|
Dazwischen struppt allerlei graubraunes Trockengewächs in allen Größen und Formen, ab und zu ein seltsamer Baum mit silbrigen Blättchen, und dann eine Riesenrunkelrübe, die sich beim Näherkommen als echter madegassischer Baobab entpuppt. Je weiter man in die Wildnis vordringt, desto unwirklicher wird die Vegetation. Sind wir in Michael Endes Fantásien gelangt? Oder gar auf einen anderen Planeten? Keine einzige Pflanze, die wir schon einmal gesehen hätten, lauter irre und bizarre Gewächse, über die man nur den Kopf schütteln kann. Da staunt der Fachmann, der Laie aber wundert sich über so eine Sciencefiction-Landschaft. Hier ist sie also, die berühmte endemische Vegetation.... Als Gott die Bäume erschuf, musste er zuerst ein bisschen üben. Alle missratenen Exemplare stellte er auf Madagaskar ab. Dort sind sie als Baobab bekannt, stehen bis zum heutigen Tag im unzugänglichsten Stacheldickicht und schämen sich ihrer traurigen Gestalt. Rübenhaft aufgedunsene, meterdicke Stämme, oft wie Ginsengwurzeln zu Zwillingen verwachsen, und rührend kurze, mickrige Zweige, an denen braune Bommelfrüchte baumeln. |


Runkelrüben-Baobabs und Landschaft eines fremden Planeten
|
Die Wildnis ringsum
präsentiert sich in allen Grau- und Brauntönen; leben
diese
Stachelbüsche überhaupt, oder sind sie verdorrt?
Dazwischen
die rötlich erdigen oder bleigrauen Stämme der
Baobabs, die wie
Wachttürme längst verfallener Burgen wuchtig im Sande
stecken
--- nur Grün ist hier etwa so rar wie Lila im deutschen
Tannenwald. Da gehste und guckst und staunst, links ein uriger
Riesenkaktus, rechts ein lachhafter Super-Baobab, und schon steht
die Sonne tief und wir stecken in den stacheligen Tiefen des
afrikanischen Trockendschungels und müssen langsam zusehen,
dass
wir aus dem Sandlabyrinth wieder herausfinden.
|