
≪≪≪≪≪≪ M A D A G A S I K A R A ≫≫≫≫≫≫
August 1992
2

|
Zähneklapperfröstelkalt ist es früh um halb sieben am Busbahnhof von Toliara. Um den größten Teil unseres Banknotenbündels und einige weniger wichtige Gepäckstücke erleichtert (, die wir im MORAMORA zum Aufbewahren gelassen haben), schlottern wir in der Dunkelheit, die von wartenden Menschen, aber keinem busartigen Kraftwagen erfüllt ist. Im Morgengrauen erkennt man bald die Umrisse der winterlich in Decken gehüllten Malagasy, die es sich auf dem ölig-staubigen Boden zwischen Warenballen, Haustieren und unzähligen Kleinkindern unbequem gemacht haben und zum Zeitvertreib die zwei Vazaha mit ihren Rucksäcken beglotzen, wie die übernächtigt und frierend auf den verspäteten Bus warten. Die Sonne geht auf, die Schatten werden kürzer, die Kälte weicht, der Magen knurrt. Allein, es fehlt der Bus. |

Nur ein Rad musste noch gewechselt werden
|
Halb neun zeigt die
Uhr, als er endlich vorfährt. Ähnliches hatten wir
auch in Peru
erlebt und hofften, jetzt werde die Busmannschaft mit
ähnlicher
Verve ranklotzen wie in Südamerika, aber weit gefehlt:
Moramoramoramoramora! Bis die zwei lahmdösigen Helfer die
Körbe mit den Truthähnen, Reissäcke und
Ölkanister der
Passagiere aufs Dach gehievt und festgezurrt hatten, war es halb
10, und als die Fahrgäste, nach Namensliste handverlesen,
endlich alle drinsaßen, hatte ich schon Kohldampf aufs
Mittagessen. Vorher muss der gute Omnibus aber erst noch 100 l
Diesel eingeflößt bekommen und nach wenigen
Kilometern auf
guter Asphaltstraße einen technischen Halt einlegen, halb
auseinandergeschraubt und dann wieder zusammengeklempnert werden, auf dass er für die restlichen 240 km halten möge.
|
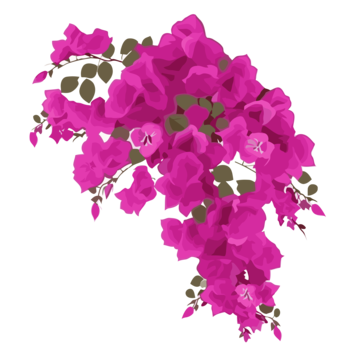
|
Ranohira mit seinen 2
Kirchen und 39 Häusern längs der Chaussee von Toliara
nach
Fianarantsoa ist zwar Provinz-Hauptdorf und verfügt stolz
über
ein eigenes Postamt, hat aber weder Strom noch Wasserleitungen.
Das ist in der madegassischen Provinz nichts
Außergewöhnliches. Gekocht wird über dem Holzfeuer, dessen Rauch täglich
24
Stunden aus jedem Lehmhaus kokelt, Licht bringen Kerzen oder, bei
wohlhabenderen Haushalten, auch Petroleumfunzeln, und Wasser
holen die Frauen aus einem der vier Dorfbrunnen, Eimer und
Kanister auf dem Kopf balancierend.
|

Hotel- und Businessviertel im Stadtzentrum von Ranohira
|
Seine Attraktivität für fremdländische Besucher bezieht der Ort denn auch weniger aus seinem Charme, als vielmehr durch seine Lage am Fuß des Isalo-Gebirges, das von Madagaskar-Kennern einhellig als Nonplusultra gepriesen wird. Als wir im Abenddämmern dem Reisemobil entstiegen und erste Blicke auf die Front der Lehmhütten warfen, waren wir uns sofort einig: Lieber im Zelt übernachten. Die Reue kam rasch und war bitter; das linde Abendlüftchen legte in der Nacht dermaßen zu, dass wir samt Zelt beinahe davongeflattert wären, und die Temperaturen sanken auf ziemlich winterliche Werte. Der
Chor unserer
klappernden Zähne muss weithin vernehmbar gewesen sein, denn
als
wir uns im Morgengrauen aus den Decken wickelten, standen schon
zwei Jungs vor unserer Stofftür und wollten uns guiden. Na,
den
Weg in den Ort werden wir schon selber finden! |

...sogar mit Stromleitung
| Ein gemütlicher, dicker Herr empfängt uns stolz in einer Hütte mit der halb abgeblätterten Aufschrift |
| SERVICE
DES EAUX ET FORÊTS |
|
Mit amtlicher Miene lässt er sich unsere teuer bezahlte Lizenz zum Betreten des Nationalparks vorzeigen, auch die Pässe und Flugtickets, als wäre er der Präfekt von Südmadagaskar, bevor er mit sichtlichem Bedauern kundtut, dass er seit geraumer Zeit nicht mehr für den NP zuständig sei; wir sollten uns an den Wirt des Hotels "Les joyeux lémuriens" wenden. Mit jovialer Handbewegung sind wir entlassen, die Audienz ist beendet. Vor der offenen Tür und dem glaslosen Fenster warten unbeirrt unsere künftigen Guides und verfolgen uns aufmerksam zum genannten Hotel. Das ist ein zweistöckiges Lehmziegelhaus, eine holzgezimmerte Treppe ist außen angebracht und führt zu einer schilfüberdachten, ebenso hölzernen Veranda am Obergeschoss. Da steht ein langer Tisch und an dessen Kopfende ein mit Papieren überladener Schreibtisch, und dahinter thront ein Mensch, der wie ein nur unwesentlich schlankerer Zwillingsbruder des ersten Ex-Amtmannes aussieht, aber ohne dessen Freundlichkeit. "Wo sind Sie denn
einquartiert?", knurrt er uns an, die Nationalpark-Lizenz
interessiert ihn nur am Rande. Von der Veranda aus hat man einen
guten Blick über die gegenüberliegenden Bauten. An
jeder
zweiten Eingangstür hängen "Hotely"-Schilder, es ist
kaum zu fassen. |

Blick vom Fenster des Gasthofs von Ranohira
|
Die Stuben seines
Hauses gleichen unseren Bauernstuben des vorigen Jahrhunderts.
Gekalkte Wände, ein roh gezimmertes Bett, Bohlendecke und
-fußboden, handgefertigt Stuhl, Spiegel und Tisch, zwei
Kerzenständer drauf. Ein glasloses Fenster mit
hölzernem Laden
und dickem Riegel dran. Sieht aber alles sehr, sehr sauber aus, viel
besser, als man dem Haus von außen ansehen würde.
Gut, machen
wir sein Spielchen mit! |
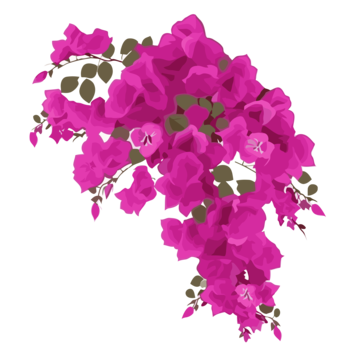
|
Vor dem Haus warten noch
immer "unsere Guides". Ich frage sie, wo die Post
ist, obwohl ich das Gebäude längst gesehen habe. Dann
tun wir
so, als müssten wir noch mal ins Hotel und sehen durch die
Zaunlatten, dass die gelangweilten Jungs tatsächlich in
Richtung
Postamt verschwinden, wo sie vermutlich den ganzen Tag auf uns
warten werden. Wir verlassen das Haus nämlich umgehend in der
Gegenrichtung und beginnen ohne Eskorte unseren heutigen
Spaziergang in den Nationalpark.
|

Zukünftige
Guides ?
|
Die Wanderkarte ist so vorzüglich, dass wir auch unbegleitet bis zum Fuß des Berges gelangen, und von da an gibt es ohnehin nur noch einen einzigen Pfad. Das Gebirge hat man von Ranohira aus stets vor Augen, ein bisschen welliges Grasland und ein paar Reisfelder liegen dazwischen. Das Ziel für heute ist in einer behäbigen, dreistündigen Altherren-Wanderung bequem zu erreichen, denn das zerklüftete Isalo-Massiv ist kein Himalaya, sondern eher ein etwas schroffer, felsiger Odenwald. Ranohira liegt in 830 m Höhe, und wir klommen gerade mal bis 930 m, den ausgetrampelten Pfad stets vor Augen. Aber die Landschaft ist grandios: Das Massiv ist "ruiniforme", durch Erosion zu den tollsten Formen zerfressen. Da liegen Plateaus, die sehen aus, als seien sie von Khmer-Tempeln übersät, in andere Felsformationen hat der Zahn der Zeit dorische Säulen wie auf der Akropolis genagt, und die drüber wegziehenden Wolken tuschen scheckige Muster auf den Steingarten. Immer kurioser auch die Flora, jetzt wird es langsam doch madegassisch-exotisch: Weiche, grasartige Kakteen mit kleinen roten Blüten, fleischige Sukkulenten in harten Felsnischen, und dann halten wir die Luft an: Eine dicke, metallisch glänzende Granate mit glimmender Lunte liegt vor uns, fast mitten auf dem Weg! Und noch mehr, hier eine und da eine..... ----- blühende Mini-Baobabs! Fast kugelrund, in für vernünftige Pflanzen idiotischem, metallic-grauem Lack glänzend, mit ein paar Warzen und Auswüchsen wie der Planet des Petit Prince und zwei bis drei luntenartig lang gezogenen Stängeln, an deren Spitze eine leuchtendgelbe Blüte wedelt. |

Eine dicke, metallisch glänzende Granate mit glimmender Lunte liegt auf dem Weg....
|
Diese drolligen Gewächse halten sich nur an spinnwebdünnen Haarwurzeln fest, und wer mit dem Lachen über solche Missgeburten von Pflanzen fertig ist, kann den handballgroßen Olli ohne weiteres liften und sich nur wundern, dass diese Bonsai-Baobabs nicht bei jedem Stürmchen davonkullern wie die Köpfe der französischen Revolutionäre. Zuletzt führt der
Pfad
hinab in eine Oase, wo ein gluckerndes, farngesäumtes
Bächlein
ein paar Meter in die Tiefe purzelt und ein paradiesisch
schönes, wie von Gartenkunstmeistern angelegtes, tiefes Bassin
bildet, in dem man nach Herzenslust baden kann. Tun wir aber
nicht, denn ringsum geht es ziemlich hoch her. Nur vier
Ausländer, aber ein gigantischer Tross von Führern
und
Trägern. Als wären sich zwei afrikanische
Busch-Expeditionen
begegnet. Auf dem Rückweg
begegnen uns noch vier weitere Safaris, bepackt, als gehe es auf
Rhinozerusjagd, und jedesmal fragen die Malagasy entgeistert:
"Sans guide?" |

Ohne Safaris und furzende Sherpas ist der Isalo-NP paradiesisch
|
Der lange Tisch auf der
petroleum-befunzelten Veranda der "Fröhlichen Lemuren"
füllt sich langsam mit Vazaha-Volk. Sechs Italiener, je ein
britisches und ein französisches Pärchen, ein
Australier und
wir beide. Keiner von denen ist auf de-luxe-Safari. Sonst
würden
sie nicht beim Lemurenwirt nächtigen. Der Australier mit
seiner
Rum-Bottel (das Zeug verdünnt er vorsichtig mit Cola, die hier
fast doppelt so viel kostet wie die gleiche Menge Rum) turnt
schon seit drei Wochen allein durch die Isalo-Felsen, und die
andern kichern ebenfalls über die emsigen Guides. Die
Mutti-Madame verwöhnt uns mit eigenhändig
gewürzter Suppe und
hervorragender Hausmacher-Kost und schleppt dann eine Wanne voll
heißen Wassers von der Feuerstelle her, damit wir uns bei
Kerzenlicht hinter einem Lattenzaun säubern können
vorm
Schlafengehen. Trotz des äußerst schlichten Komforts
ist auch
Ka, die an Herbergen normalerweise andere Ansprüche zu
stellen pflegt, mit der freundlichen Hausmutter hochzufrieden -
die Betten sind frisch bezogen, neue Kerzen und Streichhölzer
liegen bereit. Aufrichtigen Respekt der fleißigen Madegassin!
|
≪≪≪≪≪≪≫≫≫≫≫≫
|
Afrika geht mit den
Hühnern zu Bett und ist bereits beim ersten Hahnenschrei wach.
So konnten wir trotz des frühen Aufbruchs den schon auf uns
lauernden "Guides", die wir am Vortag ins Bockshorn
gejagt hatten, nicht entgehen. Kurz vor dem Verlassen des Ortes
holten sie uns ein, einen dritten Typ mit sich führend. |

Zebu-Herde im Grasmeer der baumlosen Savanne
|
Obwohl es im hiesigen
Winter nachts empfindlich kalt werden kann, brennt tagsüber
die
Sonne doch gewaltig auf die Wanderköpfe; als die Hitze schier
unerträglich wurde und unsere Mittagsrast fällig war,
brummelte
auf einmal von der bisher vollkommen menschenleeren, einsamen
Staubpiste her Motorengeräusch, und zwei bis zum Dach bepackte
Allrad-Jeeps, aus denen Blonde und Blondinen lugten, holperten an
uns vorüber. Ein Dutzend Führer, Träger,
Dolmetscher, Fahrer
und Steppenköche, die auf dem Dach hockend
durchgeschüttelt
wurden, winkten uns zu, und dann wurde der Spuk von einer
mächtigen Staubfahne wieder verschluckt. Moramora, immer mit der Ruhe! Es ist halb zwei, nur noch 8 km liegen vor uns, ist doch schon mal gold. Der Weg führt einen schmalen Fluss entlang in eine schattige Oase. Das Gewässer muss durchwatet werden, dann kämpfen wir uns durch knöcheltiefen, brennend heißen Sand, noch immer dem entfleuchten Luftverpester hinterhertrauernd, japsen durch schattenlose Ebene am nächsten Dorf Tameantsoa vorbei, wo uns ein altes Ehepaar auf dem harten Acker, die Hacken fallen lassend, nachstarrt, als seien wir geradewegs vom Mars herbeimarschiert. Zu Fuß kommen Ausländer hier anscheinend nicht öfter entlang als der Halleysche Komet. |

Das Gewässer muss durchwatet werden
|
Aus fernem Talesgrund
blinkt es im tiefstehenden Sonnenlicht: Drei friedlich parkende
Jeeps enthüllt der Feldstecher. Und einen Trek, der sich vom
Savannenparkplatz aus auf die nahe Felswand des Isalo zubewegt.
Bei unserem Nahen grüßt "unser" Chauffeur so
einfältig, dass wir ihm nicht mal richtig grollen
können. Um
nicht zwischen den Dieselschluckern, die uns jetzt nichts mehr
nutzen, übernachten zu müssen, schlagen wir uns in
die Büsche,
wo der schmale Saumpfad beginnt, der eigentliche Trek ins
Isalo-Massiv.
Nun erfahren wir auch,
weshalb "unser" Vehikel halb leer hier hergekommen ist:
Eine wahre Völkerwanderung, acht Franzosen und 30 Mann
schwarzes
Dienstpersonal, kommt matt aus dem Berg gestiegen, und alle
sehnen sich lautstark nach den wartenden Fahrzeugen. Jeder zweite
der einheimischen Lakaien fragt uns mit gerunzelter Stirn:
"Vous êtes sans guide?"
Langsam wird mir das zu
blöde.
"Der hat
Bauchgrimmen gekriegt, ein Bein gebrochen und Durchfall, und
musste umkehren", gebe ich zurück, oder "der sammelt
schon Holz fürs Abendessen."
Kann ja sein, denn hier
sieht man erstmals eine gewisse Anzahl von Bäumen, die es,
wenn
sie noch Verstärkung holen, irgendwann mal zu einem
Wäldchen
schaffen. Wasser wäre uns freilich lieber gewesen, denn ich
habe
den ganzen Tag an meiner Wasserpulle genuckelt, die jetzt fast
leer ist. Einer der Franzosen, den ich nach Wasser, Quell oder
Bach in der Nähe frage, sagt, ja, Wasser hat's im Berg,
fünf
Wegstunden von hier. Wahrscheinlich hatte er seine Brille nicht
dabei oder einen leichten Sonnenstich weg gehabt: Schon wenige
Minuten später baumeln unsere heißgelaufenen Flossen
in einem
klaren Bergbächli, und noch 100 m weiter lädt eine
schattige
Senke voller Sumpf und Rinnsalen, den Zebu-Spuren zufolge
offensichtlich die hiesige Viehtränke, dazu ein, Etappe zu
machen und unser Taschenhotel hier aufzupflanzen, just am Fuß
des Berges.
|

Die Viehtränke ist der ideale Zeltplatz
|
Das
Abendmenü:
Auf
einem japanischen Grillrost steht ein thailändischer Topf, mit
chinesischer Suppe gefüllt, die über einer Glut, mit
Papua-Zündhölzern entfacht, unter madegassischem
Sternenhimmel
blubbert, auf dass ein deutscher Fahrensmann sich den Wanst damit
fülle.
|
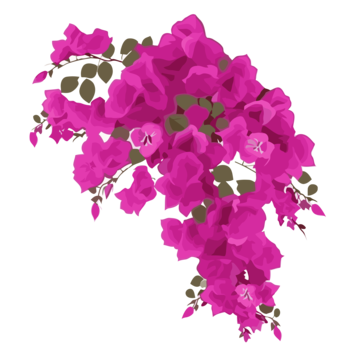
|
Steinig und steil,
trocken und heiß war der menschenleere Pfad, der anderntags
zu
bewältigen war, bis wir am Nachmittag das erste Ziel
erreichten.
Weil wir uns der Führer entledigt hatten, mussten wir, wenn es
über steinigen Grund ging, bisweilen schon mal suchen, bis wir
den kaum sichtbaren Pfad wiederfanden, aber die mit Wegsuche
verlorene halbe Stunde ist nichts gegen den Vorteil, ohne
labernde oder furzende, drängelnde oder belehrende Mitesser
unterwegs zu sein. Ich würde gewiss eher auf das Trekking
verzichten als noch Tagelöhner mitschleppen. Ohne Aufpasser
kann
man Fotos und Pausen machen, wann man will, essen, furzen und pinkeln,
wo
man will, selbst entdecken und untersuchen, was man will, und all
das ohne einen Laut außer dem Brausen des Windes und dem
Singen
der Vögel. Im Isalo gibt es kein Dorf, keine Hütte,
keinen
Generator. Hier töffelt kein Buschtaxi, knattert kein
Hubschrauber. Auf dem Plateau ein Grasmeer, im Wind sanft wogend,
in dem sich der Pfad fast verliert, ringsum zerklüftete Felsen
und halsbrecherische Canyons.
|

Auf dem Plateau ein Grasmeer, im Wind sanft wogend