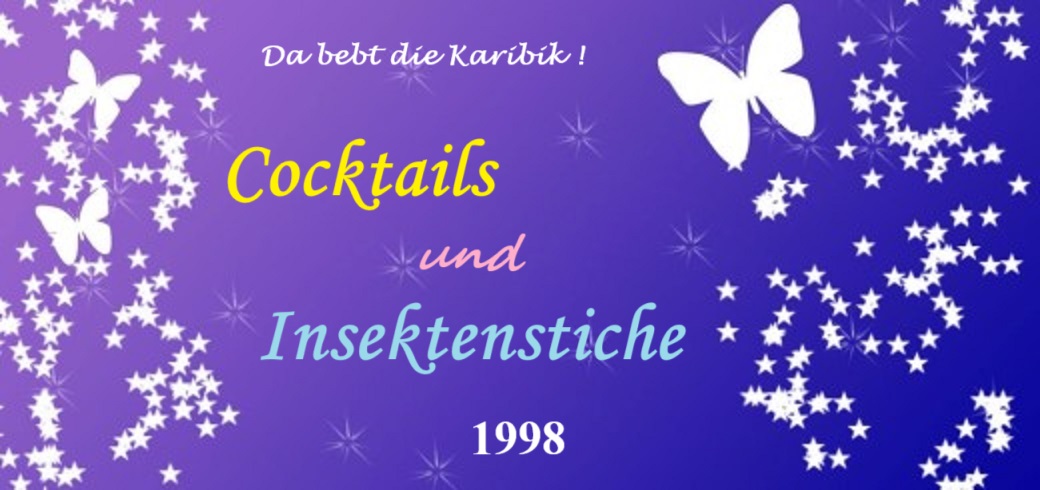


SCHMETTERLINGSORCHIDEE MARIPOSA, CUBAS NATIONALBLUME
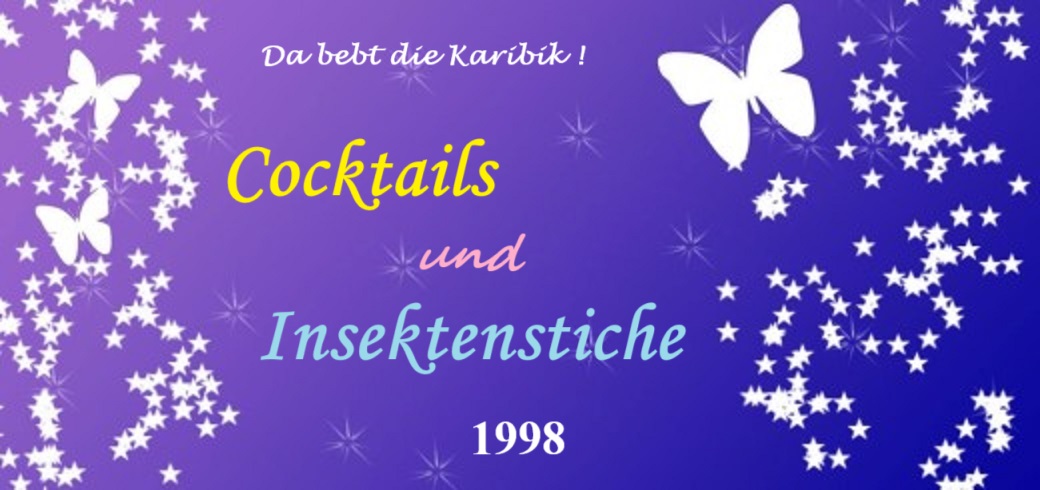


SCHMETTERLINGSORCHIDEE MARIPOSA, CUBAS NATIONALBLUME
|
Mit auf Stadtrundfahrt waren auch vier lustige junge Mädels aus Guayaquil im Süden von Ecuador, die im selben Hotel wohnen wie wir. Die Empörung über den Fischsalat beim Frühstücksbuffet, der nun schon den vierten Tag hintereinander aufgefahren wird und längst keinen Hautgout mehr hat, sondern im Verlauf seines Verwesungsprozesses mittlerweile stärker stinkt als der Käse, bringt uns ins Gespräch miteinander; und der Gesprächsstoff geht uns nicht aus, denn sie haben mindestens ebenso viele Fragen über Japón und Alemania auf Lager wie wir über Ecuador. Auch dort kommt man nicht allzu leicht an Dollars heran, und selbst betuchte Leute, zu denen unsere vier Bekannten zweifellos zählen, können sich Urlaubsflüge nur zu preisgünstigen Ländern leisten, und da steht Cuba mit an erster Stelle. Touristen aus englischsprachigen Ländern sieht man auf Cuba ziemlich selten; stattdessen wimmelt es vor Spaniern, Mexicanern, Südamerikanern, Franzosen und den unvermeidlichen Deutschen, die vermutlich auch in Timbuktu, am Nordpol und auf dem Mond nach Bier, Badestrand und Bildzeitung suchen. Das Hotelfrühstück hat auch gute Seiten: Obst scheint hier billig zu sein, denn wer die toten Fische verschmäht, kann sich stattdessen an Bergen von Ananas, Bananas und Papayas sattfressen, dazu Guayavas (bei uns heißen die abgekürzt Guavas), Pampelmusen, Wassermelonen und leckeres Gebäck probieren. Aus dem Kran mit der Aufschrift TropiCola spudelt Bitzelwasser, was mir hochwillkommen ist, doch leider versiegte der Quell bereits am Morgen des dritten Tages. Da
wir die
Hotelküche voller Misstrauen als eine Art
Staphylokokken-Biotop
betrachten, gehen wir an täglich wechselnden Orten
auswärts
speisen und fahren damit sehr gut. Ich hätte nie geglaubt,
dass
man in La Habana auf eine solche Fülle ausgezeichneter
Restaurants
stoßen würde, deren Preise, natürlich nur
in Dollars, nur etwa
30% bis 40% dessen betragen, was man uns in Jamaica für
weitaus
lumpigere Gerichte abgeknöpft hat. Ein rustikales Gasthaus (El
Conejito) mit Konzertflügel und Weinregalen im
geräumigen
Gästeraum, das auf Karnickel-Menüs spezialisiert ist? Ein
Meeresziefer-Tempel, der Hummer für 17,50 $ auftischt? Ein
luschiges Gartenrestaurant (Mina) mit Springbrunnen und
freilaufenden Pfauen im Atrium, wo dem Gast zur
Begrüßung ein
Glas Guarapo aufgetischt wird? In La Habana findet man das. |

CUBANITAS
|
Frei
sind wir
auch. Auf Cuba kann man sich tatsächlich überall
ungehindert
bewegen, solange man nicht über Kasernenhöfe
spaziert. Gegen
solche Besuche sind freilich alle Militärs der Welt
allergisch.
Man kann sich sogar ein Auto mieten und herumfahren, wo immer man
mag, und genau das haben wir auch im Sinn. Die Autovermieter
kommen jedoch durch den unerwartet massenhaft ins Land flutenden
Touristenstrom mit ihren Karossen nicht nach, und vergeblich
sprechen wir bei allen einschlägigen Agenturen vor. Endlich
treffen wir ein französisches Ehepaar, das gerade seine
Karre
zurückbringt, aber die Gattin, die neben uns sitzt,
während ihr
Mann die Formalitäten erledigt, ist so liebenswürdig,
uns
aufzuklären:
"Um
Gottes
Willen, mieten Sie hier keinen Wagen! Wir haben alle 25 km einen
Plattfuß gehabt, der Tankverschluss fehlte, der Tacho war
defekt
und das Öl tropfte leise, aber stetig..."
Wir
sagen der
Dame unseren herzlichsten Dank und buchen bei Havanatours
Busfahrten zu den nächsten Reisezielen. |

|
Die gewaltigsten
Ungetüme, die sich durch Habana schlängeln,
heißen Camellos
und befördern die Cubaner unermüdlich zum
Arbeitsplatz oder zum
Karneval und wieder zurück. Es sind Sattelschlepper, auf denen
ein riesiger Fahrgastwagen mit Kamelhöcker aufliegt. Dieses
Massentransportmittel ist cubanischer Eigenbau, und die Cubaner
sind mächtig stolz auf ihre Camellos.
|

CUBANISCHES KAMEL
|
An der Haltestelle fragt jeder Neuankömmling "¿último?" (wer ist der letzte?), merkt sich seinen Vordermann und sucht sich dann einen schattigen Platz auf der nahen Wiese. Naht ein Bus, hört man das Dieselgrollen schon von weitem, und wie von Zauberhand gefügt bildet sich eine disziplinierte Reihe, indem sich jeder hinter denjenigen einreiht, der sich zuvor als "último" geoutet hatte. Man fragt am besten einen Passanten, welcher Bus wohin fährt und wo die Haltestelle ist, und wenn der Mensch so nett ist, dich bis zur Station zu geleiten, drückst du ihm einen Dollar in die Pfote, da freut er sich ein Loch in die Mütze. Kommt der Schaffner und will 40 Centavos pro Person kassieren. Ich geb ihm eine US-Münze zu 25 Cents, Pesos und Centavos hab ich keine. Flink lässt der Bursche die Münze in die Hosentasche gleiten, gibt uns zwei Fahrscheine und hofft, dass wir nicht merken, dass uns - auch nach offiziellem Kurs - eine Menge Wechselgeld zusteht. Aber was soll ich mit den cubanischen Alu-Centavos? Ich lasse ihm seinen Gewinn, auch wenn wir im proppevollen Bus nicht mal Aussicht auf Sitzplätze für unsere Valuta haben. |
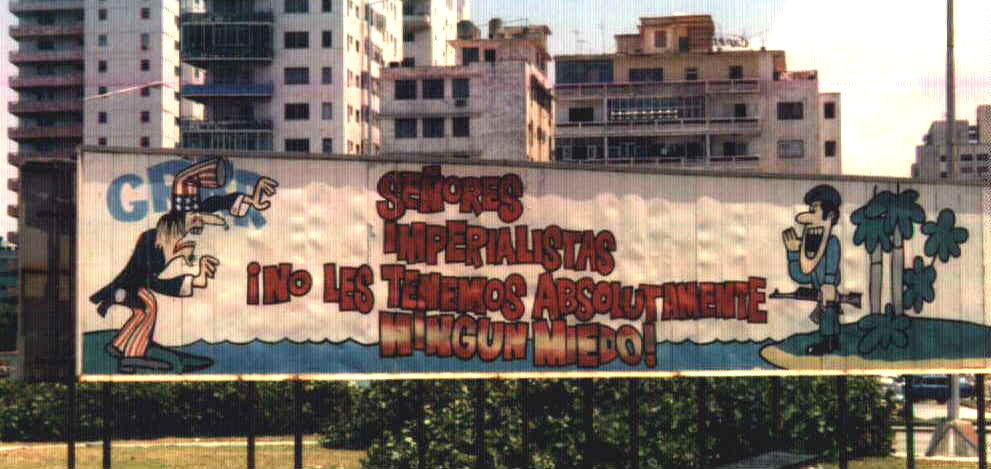
|
"Señores imperialistas, ¡no les tenemos absolutamente ningun miedo! = Ihr imperialistischen Herrschaften, vor euch haben wir absolut keinen Bammel!" Sprüche dieser Art zieren hier und da Straßenkreuzungen in Habana, aber von harter kommunistischer Propaganda ist auf Cuba wenig zu sehen. Castro setzt mehr auf seine wirklichen Errungenschaften als auf plumpe, leicht durchschaubare Propagandaparolen. "50 mil niños mueren cada día de enfermedades curables - ninguno es cubano. = Fünfzigtausend Kinder sterben Tag für Tag an heilbaren Krankheiten - keines davon ist aus Cuba", sagt beispielsweise ein anderes Plakat. Die cubanische Armut unterscheidet sich nicht sonderlich von der Armut anderer, auf kapitalistische Rezepte setzende Drittweltländer. Dort geht es nur der Oberschicht besser, die Armen leben hingegen noch elender als die Cubaner. Hier sind immerhin Bildung und ärztliche Versorgung für jedermann kostenlos, weshalb die Sterblichkeitsrate unter cubanischen Kindern wohl tatsächlich niedriger liegen dürfte als in Haïti oder Guatemala. In jedem Wohnviertel muss sich ein Arzt niederlassen und seine Praxis betreiben, und selbst im parkähnlichen Villenviertel Vedado (vedado bedeutet "verboten", denn das Viertel war einst off limits für den gemeinen Pöbel) wohnt heutzutage, wie man uns nachdrücklich versichert, "das Volk", wer immer das sein mag. Nach Proletariat sehen die Traumvillen mit ihren Schnörkeln, Balustraden und Verandas jedenfalls nicht aus. Einige der frisch renovierten Anwesen sind als Botschaftsgebäude kenntlich gemacht, an einem anderen Haus prangt ein Schild "Unión de escritores y artistas" (Verband der Schriftsteller und Künstler), und im schattigen Garten sitzen junge Leute unter Hibiskusbüschen und lauschen emsig mitschreibend der Vorlesung eines bärtigen Gelehrten. |

|
Eigentlich
war
es das Guidebook für Jamaica, das uns zu dem Trip nach Cuba
animiert hatte; dass der Autor, ein eingefleischter Jamaica-Fan,
freimütig zugibt, dass Cuba "garantiert zehnmal so
amüsant
und interessant ist wie Jamaica", hat uns überrascht. Mit
sozialistischer Mangelwirtschaft und schlappem Service hatten wir
schon in anderen Ländern unliebsame Bekanntschaft geschlossen
und beäugten Cuba deshalb eher misstrauisch als interessiert
auf
der Landkarte. Inzwischen sind aber sogar wir Gruftis
dermaßen
in den Sog von La Habana geraten, dass wir wie die Einheimischen am
Nachmittag Siesta halten, um das Nachtleben in vollen Zügen
genießen zu können.
Im Salón rojo ist
Cabaret, fängt um 22
Uhr an und endet um 4 Uhr früh. Cabaret heißt Disco
bis um halb
eins, und dann beginnt eine heiße cubanische Show auf der
Bühne, halb Moulin rouge, halb Varieté, mit viel
Salsa und gut
gebauten Señoritas, und das für 5 $ Eintritt, dazu
ein Getränk
für 2,50 $, aber da kann man die ganze Nacht lang dran
nuckeln,
wenn man geizig ist, ohne dass man zum Nachfüllen
gedrängt
wird. Und beim Verlassen des Etablissements in den frühen
Morgenstunden sind die Straßen belebt, die Cafés
überfüllt,
die Busse fahren ebenso wie am Tage - muss denn hier keiner am
Morgen ins Büro, produzieren die Fabriken ihre Traktoren denn
ohne fleißige Arbeiter?
|

CUBANISCHES NACHTLEBEN FÜR TOURISTEN
|
Noch besser angelegt
sind 5 $ Eintritt in dem Jazzkeller LA ZORRA Y EL CUERVO, wo
man beinahe vergisst, dass man in Cuba ist. Die Bude ist genauso
verqualmt und bekifft wie die entsprechenden Szenecafés in
Kreuzberg, die Besucher sind ebenso jung und zahlreich wie in
Schwabing, nur dass hier die Umgangssprache Spanisch ist. Im
Scheinwerferlicht in einer Ecke eine kleine Bühne, und
lässige
Jungs, ihrem Aussehen und Alter nach wohl Studenten, greifen sich
ihre Gerätschaft und fetzen cubanischen Jazz runter, bis sie
schweißgebadet sind und ihr Horn einem Kollegen
weiterreichen,
der seinen Cocktail stehen lässt, auf die Bühne
hüpft und
gleich das nächste Solo bläst. Der Pianist, ein
bleiches
Jüngelchen mit dicker Stadtneurotiker-Brille, spielt seinen
Part einhändig; den Kopf hat er dabei nach
rückwärts gedreht
und flirtet während des Spielens mit der Señorita
vom
Nachbartisch. Ihm folgt ein schwarzer Pianist, der den Kasten
derart durchquirlt, dass wir meinen, gleich müsste der Deckel
wegfliegen.
Just da kommt ein anderer beleibter Schwarzer zur
Tür herein. Beifall brandet auf. Der Pianist macht dem
offenbar
prominenten Neuankömmling ehrerbietig Platz, und der hockt
sich
vorsichtig, damit der Hocker nicht bricht, an die Klimperkiste,
fasst den Flügel mit seinen Pranken, als sei er eine
Ziehharmonika, und holt nicht nur virtuos, nein, geradezu
akrobatisch, so unfassbare Sequenzen aus dem Ding, dass Chopin
und Liszt, hätten sie das gehört, bleich aus dem
Lokal
geschlichen wären und den Beruf gewechselt hätten.
Wie besoffen
von dem musikalischen Schmaus, mehr als vom Alkohol, fragen wir
uns auf dem Rückweg ins Hotel gegen 4 Uhr morgens in der
Menschenmenge erneut, wann die Bewohner von La Habana eigentlich
schlafen gehen.
|

JAZZ IN LA ZORRA Y EL CUERVO
|
Die
Zapata-Halbinsel bildet das rechte Hinterbein des
"Krokodils", wie die Cubaner ihre langgestreckte Insel
nennen, und ist über die schnurgerade und leere, sechs- bis
achtspurige Autobahn in knapp zwei Stunden flotter Fahrt zu
erreichen. Flotte Fahrt - das gilt nur für unseren brandneuen
Daimler-Bus von Havanatours. Hier und da schleichen Oldtimer mit
30 bis 50 Sachen über den Asphalt, und fast ebenso viele
Wagen,
wie auf der Piste rollen, stehen schnaufend am Rand derselben,
während die Insassen ölverschmiert mit
Schraubenschlüsseln,
Hämmern, Ölkanistern, Zangen und Luftpumpen ihrem
rollenden
Methusalem wieder auf die Pneus zu helfen suchen.
An Ein- und
Ausfahrten stehen "damas amarillas", die "gelben
Damen" mit warngelben Leibchen um die Brust, die alle
nicht-privaten Fahrzeuge anhalten und auf freie Plätze
kontrollieren dürfen. Wie uns ein Cubaner erklärt,
müssen alle
Dienstfahrzeuge dem Volke dienen, indem sie Leute, die selbst
nicht motorisiert sind, mitfahren lassen. Ob Postauto,
Militärjeep oder Ambulanz, alle sind den "damas
amarillas" untertan.
|
|
Bis
Guamá
schweift der Blick über Obst- und, natürlich,
Zuckerrohrplantagen, doch Cuba ist nur der
drittgrößte
Rohrzuckerproduzent der Welt, nach Indien und Pakistan. An der Bahía
de los
cochinos,
der berühmten Schweinebucht in der Provinz Matanzas, sieht man
weder Invasoren noch sonstige Schweine, nur ein Denkmal für
die
Genossen, die bei dem dilettantischen Überfall der Gringos ums
Leben gekommen sind. Nahebei werden Krokodile gezüchtet, aber
die Viecher sind allesamt in einem weitläufig
eingezäunten
Naturpark eingeschlossen und werden wohl erst rausgelassen, wenn
der nächste Invasionsversuch stattfindet.
|

AN DER SCHWEINEBUCHT FÜHLEN SICH AUCH KROKODILE SAUWOHL
|
Die Iguanas sind erstaunlich dankbar für die trockenen Brotreste vom Frühstücksbuffet, und sogar junge, nur armlange Krokodile vergessen ihre sozialistische Lethargie für einen Kanten altbackenes Weißbrot. Über Kanäle tuckern wir per Boot durch die Sümpfe zu einer hübschen insularen Parklandschaft, in der Chalets für Hochzeitsreisende aus aller Welt leerstehen, weil die Russen jetzt allesamt in Paris und St. Moritz honeymoonen. Runde Brücken wie in Japan führen von Inselchen zu Inselchen; Wiesen, Blumenbeete und blühende Bäume werden von Kolibris umschwirrt, und neben echten Schmetterlingen trifft man auch auf solche, die nur ihrem Namen nach Mariposas sind: Es sind jene allerorts weißblühenden Orchideen, Cubas Nationalblumen. Auf
der letzten
Insel steht ein Schilfhüttendorf, eine rekonstruierte Siedlung
der Taína, der Ureinwohner Cubas, die jedoch die
columbianischen
Visiten nur um wenige Jahrzehnte überlebt haben. Mit
Verwunderung vernehmen wir daher, dass deren Rituale zur
Begrüßung von Touristen bis heute
überliefert sein sollen. In
der Hütte des Kaziken wird das Misstrauen bestätigt:
Das
wichtigste Gerät beim Taína-Ritual ist
nämlich der Teller, mit
dem die Dollar-Spenden eingesammelt werden.
|
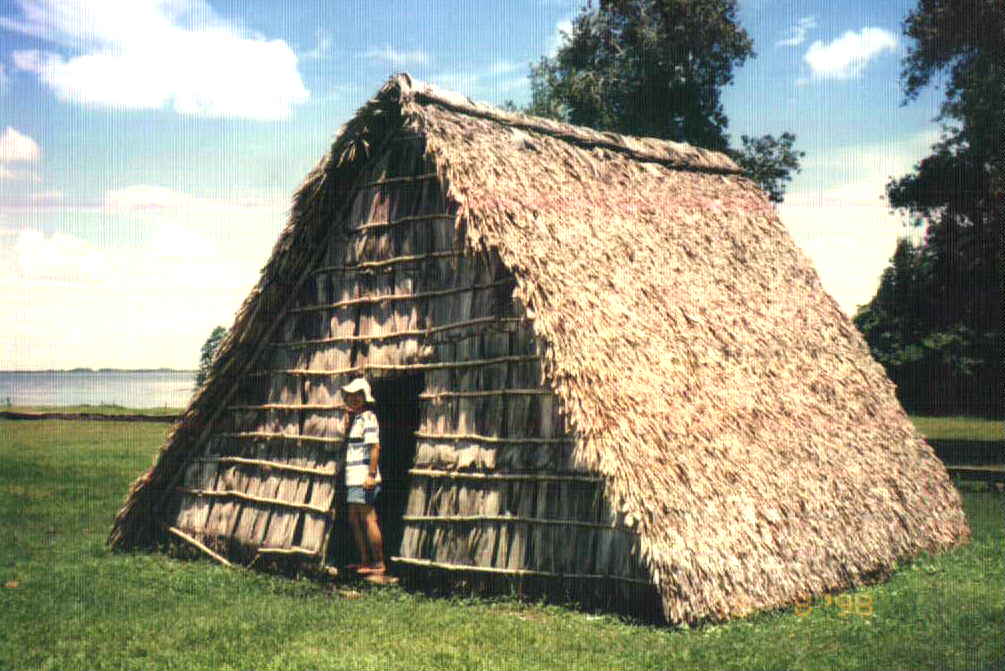
DIE LETZTE DER TAÍNAS?